Obwohl Irene Rinke ihrer Selbsteinschätzung nach eine fabelhafte Schwiegermutter abgegeben hätte, irritiert es sie ein wenig, dass die andere Irene und ich ein so trauliches Verhältnis miteinander haben, und so gab sie mir, fast wie ein Schulbrot, die Bemerkung mit auf den Weg: „Denk daran, dass alles, was du sagst, in irgendeiner Form literarisch ausgeschlachtet werden wird!“ Dieser Hinweis kam mir etwas seltsam vor, fast wie die Ermahnung einer Zigeunermama, die ihren Sohn, den sie zum Klauen ausschickt, vor Taschendieben warnt.
Freitag Abend: Ich kam von der Berliner Praxis-Einweihung einer prominenten Hamburger Anwältin aus Schöneberg zurück nach Charlottenburg.
Irene Dische kam mir auf der steilen Treppe entgegen, knochenschlank, in einem ihrer Kleider, die nichts betonen: kein Dekolleté, keine Taille, keine Knie, Kleider wie Tarnkappen, als wolle sie voyeuristisch alles beobachten können, ohne selbst gesehen zu werden. Es war zehn vor acht, und ‚zwischen viertel vor und zehn vor‘ hatten wir ausgemacht; ich brauchte also kein schlechtes Gewissen zu haben. Wie wenig schlecht, wurde mir allerdings erst klar, als wir unseren Bestimmungsort erreichten: ein schön gekachelter Fleischerladen mit Haken in den Schaufenstern, an denen dankenswerterweise keine Schweinekadaver baumelten. Es war, genauer gesagt, eine ehemalige Metzgerei, die zur Weinhandlung umfunktioniert worden war. Aber auch deren Utensilien waren weggeräumt worden, und stattdessen standen vereinzelte aufgeputzte Tische herum, zwischen denen vereinzelt aufgeputzte Menschen herumstanden.
„Wir hätten doch nicht so pünktlich zu sein brauchen“, erkannte Irene scharfsinnig.
Nun wollten wir einen Gastgeber begrüßen. Jemand mit Vollbart und ausladenden Gebärden sah mir bedeutend genug aus für diese Funktion, aber Irene belehrte mich, das sei ein Ölimporteur, dessen kalt gepresster Olivenextrakt zum Verkauf in den seitlichen Regalen lagere. Ein beflissen eitler Mann im konventionellen Anzug begrüßte uns, und das war wohl der Veranstalter: ein württembergischer Weingutsbesitzer, der seine Preisliste gleich neben den Gläsern auf den Tischen ausgelegt hatte. Vor den sechs Gläsern pro Platz stand jeweils ein Teller mit einem Stück Räucherforelle und einer Scheibe Lachsterrine. Süßwasser- und Salzwasserfisch waren gegeneinander durch etwas Grünes abgegrenzt, das aussah wie eine Zahncreme mit sehr viel Fluor.
Ich hatte keinen rechten Nerv für diese kulinarischen Attraktionen, denn ich hatte auf der Büroeinweihung zuvor in der Aufregung wohl einen Schluck Wein zu viel getrunken, der nun unten gerne wieder rauswollte.
„Wo kann ich mir hier wohl mal die Hände waschen?“, fragte ich den württembergischen Weingutsbesitzer. „Links die Treppe rauf“, sagte er in seiner verbindlichen Art, die deutlich weniger dem Wunsch entsprach, menschlich zu sein, als dem Wunsch, Wein zu verkaufen.
Etwas x-beinig, mit angehaltener Blase, erklomm ich die fünf Stufen und gelangte in ein Kontor mit wuchtigem Schreibtisch und Regalwänden voller Akten. Gegenüber dem Fenster befand sich ein winzig kleines Waschbecken mit einem Stück Seife, ein ziemlich weißes Handtuch hing am Haken. Ich widerstand der naheliegenden Versuchung, stieg die Treppe wieder hinab und verschwand den Gang entlang, der ins Innere des Lagers führte, inzwischen recht deutlich x-beinig. Nach einer Weile begegneten mir zwei offensichtlich für das leibliche Wohl der Gäste zuständige jüngere Männer, denn sie standen vor einer offenen Küchentür und hielten Essbares in einer Hand. Da mein leibliches Wohl in äußerster Gefahr war, wiederholte ich meine drängende Frage, wo ich mir die Hände waschen könnte. Dabei unterstrich ich mein – ja nur fingiertes – Bedürfnis, indem ich veranschaulichend beide Hände waschzwanghaft ineinander rieb, als wären wir alle drei taubstumm. Also, taub waren sie nicht, vielleicht aber stumm, denn sie wiesen nur wortlos mit der anderen Hand in eine Richtung, in der ich dann hinter einer feuerabweisenden Eisentür nicht nur ein weiteres Waschbecken, sondern auch das Gewünschte fand.
Als ich wieder in den Ess- und Verkaufsraum zurückkam, hatte es sich ein wenig gefüllt. Irene machte mich auf eine Frau aufmerksam, die aussah wie die Tochter von Melina Mercouri und einem Pekinesen. „Das ist Marie-Luise Scherer“, sagte Irene. „Sie ist wichtig. Kennst du sie?“
Ich lese ihre Kultur-Reportagen im ‚Spiegel‘ immer mit großem Vergnügen und hatte sie mir ganz anders vorgestellt, eleganter, fragiler, obwohl sie bei aller Derbheit doch den nachdenklichen Gesichtsausdruck einer Prostituierten zur Schau trug, der klar ist, dass sie bald in das Fach der Puffmutter avancieren muss. Blöd von mir.
„Ich habe gehört, sie schreibt so furchtbar schwer“, fuhr Irene fort. „Sie ist dann ganz unglücklich und schließt sich wochenlang ein. Es ist immer eine Katastrophe, komm, wir gehen zu ihr.“
Vorher wurde ich aber noch mit Jeff bekannt gemacht, bei dem der russische Pianist Ugorski in seiner Westberliner Zeit gelebt hatte. Er sieht auch ein bisschen aus wie Ugorski in größer und hübscher. Die Begrüßung zwischen Irene und Jeff fiel so aus, dass ich merkte, wie vertraut sie miteinander sind, und er war offensichtlich auch dafür verantwortlich, dass Irene und ich hier standen, denn er schien irgendwie Verbindungen zum Wein, zum Öl oder zu dem Ladenbesitzer zu haben.
„Jeff war mit Nikolas Bruder, also meinem Schwager, zusammen in Salem. Und der war wild hinter Jeff her. Er hat ihm dermaßen zugesetzt – so verliebt war er! –, dass Jeff Jahre gebraucht hat, sich davon zu erholen. Erst nachdem er das Erlebnis verarbeitet hatte, konnte er unverkrampft schwul werden, aber sein Typ sind mehr so Muskelmänner, was ich ja schrecklich finde. Ich weiß gar nicht, was dein Typ ist.“
Wir waren inzwischen bei Marie-Luise Scherer angekommen, die sich aber in die andere Richtung hin unterhielt, und so konnte Irene mir detailliertere Informationen zuraunen: „Sie ist zurzeit mit dem Öl-Importeur befreundet, darum ist sie hier.“
Ein weiteres Paar betrat den Laden. Er, wohl mein Alter, hatte ein Gesicht, das aussah, als hätte es schön werden sollen, dann war die Zeichnung aber doch im letzten Augenblick mit dem Schwamm weggewischt worden. Sie war Monika Maron.
„Das ist Monika Maron“, sagte ich, stolz, sie gleich erkannt zu haben, obwohl ihr Gesicht in Wirklichkeit breiiger aussieht als auf Porträtfotos. Erst kürzlich hatte ich gelesen, dass sie jetzt in Hamburg wohnt, und ich wollte sie wirklich gerne kennenlernen.
„Ich weiß“, antwortete Irene. „Sie hat auch einen neuen Freund. Die beiden wollen einander ihre neuen Männer vorstellen.“
Nun küssten sich die Scherer und die Maron. Irene und ich standen irgendwie dazwischen, die beiden Partner der Küsserinnen etwas abseits. Es ergab sich, dass Irene und ich in das allgemeine Begrüßungszeremoniell einbezogen wurden, wenn auch ohne Kuss.
Die Scherer eröffnete den Dialog mit dem von ihr zu begutachtenden Maron-Begleiter: „Und Sie beschäftigen sich mit deutscher Barock-Lyrik?“
„Nicht nur“, antwortete der Angesprochene. Dann schwieg er wieder und betrachtete die Scherer mit seinem schönen, wenn auch leider weggewischten Gesicht. Da aber auch sonst keiner etwas sagte, bekam er das Gefühl, nachreichen zu müssen und ergänzte: „Das deutsche Barock hat ja nicht die Weltgeltung wie das englische oder französische.“ Ich wollte ihn nicht hängen lassen, zumal in mir die Erkenntnis dämmerte, dass die drei Damen bar jeden Wissens über das europäische Barock sein mochten.
„Sie meinen in der Literatur?“, fragte ich hilfreich.
„Überhaupt“, entgegnete er.
Nun fand ich, ein kleiner Exkurs könne nicht schaden und wägte ab: „In der Architektur ist das bestimmt nicht so.“
„Es gibt in Bayern siebenundzwanzig Barock-Kirchen ersten Ranges“, lenkte er ein.
Ich, kühner werdend: „Und in der Musik? Was ist überhaupt der Maßstab? Wenn man, um sicherzugehen, in Geld misst, dann hätte ich lieber das Original eines Bach-Manuskriptes als eine Handschrift von Purcell oder Rameau.“ Ich hatte Lully sagen wollen, weil Rameau ja mehr französisches Rokoko ist, aber Lully war mir so schnell nicht eingefallen, und ich hoffte, vielleicht merkt es ja keiner, zumal insbesondere die Damen an dieser Konversation nicht sonderlich interessiert zu sein schienen.
Monika Maron beäugte das Regal mit Flaschen neben ihr und Marie-Luise Scherer fragte meinem Empfinden nach völlig zusammenhanglos: „Siebzehnhundertvierundachtzig. Ist da Goethe geboren?“ Die Maron wandte ihren Blick von den Flaschen und sagte ein wenig gouvernantenhaft: „Goethe ist siebzehnhundertneunundvierzig geboren und achtzehnhundertzweiunddreißig gestorben.“
‚Das hätte ich schöner gesagt‘, dachte ich, aber ich schwieg. Überhaupt: 1784? Dann wäre ja die ‚Iphigenie‘ nach der ‚Penthesilea‘ geschrieben worden, aber das sagte ich erst recht nicht.
Die Scherer sagte völlig gleichgültig und völlig unlogisch: „Dann hab’ ich mich eben im Jahrhundert geirrt.“
Monika Maron nahm eine Flasche aus dem Regal. „Das ist das beste Öl der Welt“, erklärte sie, „aber auch das teuerste.“
Marie-Luise Scherer und ihr Freund traten den Rückzug an und gesellten sich zu einem anderen Kreis.
Irene nahm ebenfalls eine Ölflasche und wendete sie bewundernd in der Hand wie einen Topas. „Vielleicht kann man hier einen Nachlass kriegen.“
„Großhandelspreis“, pflichtete die Maron bei.
„Man müsste mal fragen“, sagte Irene und drehte den Kopf, „wo ist er denn?“
Ich war verblüfft und bemerkte in ehrlichem Erstaunen: „Ach, wollen hier zwei Dichterinnen um fünf Mark feilschen?“
Beide stellten wortlos, aber ohne ersichtlich gekränkt zu sein, die Flaschen auf ihre Plätze zurück.
Ich wollte etwas Unverfängliches beisteuern und sagte: „Sie leben jetzt auch in Hamburg?“
„Nein“, sagte die Maron. „Ich lebe schon wieder in Berlin.“
„Ach!“, machte Irene. „Wo?“
„Ansbacher Straße.“
Irene hatte mich, als sich die Maron uns genähert hatte, rasch noch darauf aufmerksam gemacht, dass sie auch bei Rowohlt sei. Ich sagte also bindend, verbindlich: „Sie haben ja den Verlag gemeinsam.“
„Nein“, antwortete die Maron, „ich bin bei Fischer. Rowohlt ist nur wie wild hinter mir her.“
Dies freute Irene wieder nicht so richtig.
Jetzt wollte ich aber wirklich etwas Nettes sagen. In Meran steht, als Hinterlassenschaft der Vorbesitzer unseres Hauses, Monika Marons Roman ‚Flugasche‘ rum. Da ich aber über den Klappentext nicht hinausgekommen bin, mochte ich mich auf dieses bodenlose Terrain nicht einlassen, sondern lobte wahrheitsgemäß: „Ich habe ihren Briefwechsel mit Joseph von Westphalen im ‚Zeit‘-Magazin immer mit großem Interesse gelesen.“
Sie strich mein Kompliment ein wie Wechselgeld und quittierte mit einem schmalen Lächeln.

An dieser Stelle noch eine Delle. Ich füge hier wieder ein paar Seiten aus einem früheren Brief ein, der belegt, dass ich auch als Privatier – also nach meinen Zeiten von Aufnahmen in der Philharmonie und Nächten im ‚Kempinski‘ – weiterhin am gehobenen Kulturtreiben in Ku’damm-Nähe einen gewissen Anteil nahm, bevor ich jetzt in der ‚Bar jeder Vernunft‘ meiner eigentlichen Bestimmung nähertrat: Im September 1993 verbrachte ich ein Wochenende in der Meinekestraße. Dort wohnte in elegantem Gründerzeithaus die Schriftstellerin Irene Dische mit Mann und Kindern auf einer Etage mit zwei Wohnungen. Eine davon nutzte sie mit Familie, die andere bekam ich für drei Tage. Dazu schrieb ich vor der Abreise über mein eigenes Elternhaus:

Titelbild (Symbolbild) mit Material von Bodo Kubrak/Wikimedia Commons, CC0 1.0

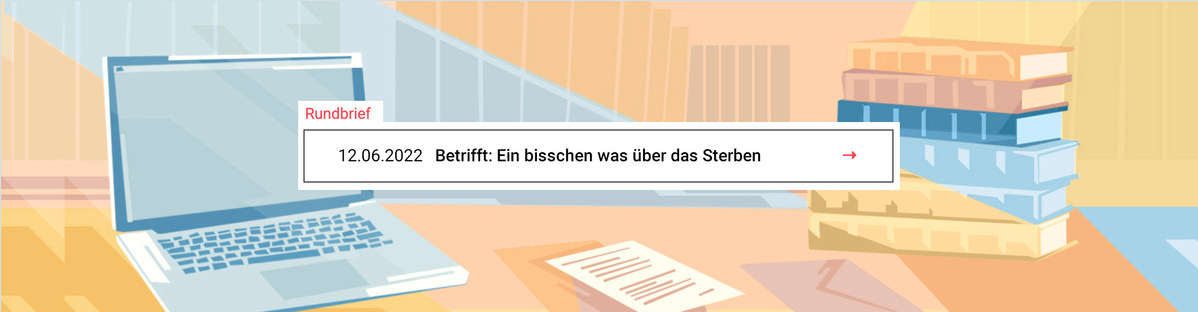







































































Hahaha, was genau ist denn die eigentliche Bestimmung?
„Bar jeder Vernunft“ das Unmöglichen anzustreben.
Monika Maron sagt mir ehrlich gesagt überhaupt gar nichts. Aber es klingt erstmal nicht so als hätte ich viel verpasst.
Sie kam wegen ihrer politischen Ansichten vor einiger Zeit wieder ins Gerede.
Ich erinnere mich ihren Namen im Rahmen der Doku „Der Fall Tellkamp“ gehört zu haben. Aber die Details sind mir schon nicht mehr im Kopf.
„Sie ist wichtig“ ist ja ein super Vorstellungs-Satz 😂
Je nachdem in welchem Rahmen man Leute trifft reicht das als Info völlig aus.
„Sie ist unwichtig“, reicht zwar auch, aber wenn sie dann später den Oscar oder den Nobelpreis gewinnt, war es eben ein Irrtum.
Man weiß in beiden Fällen jedenfalls grob wie man sich verhalten soll. Oft sind die „wichtigen“ natürlich deutlich zeitaufwendiger, die „unwichtigen“ dafür aber oft viel spaßiger.
„Spaßig“ ist für mich ein Kriterium, um „wichtig“ zu sein.
Langweilige Gesprächspartner machen einen Abend ja auch schnell unerträglich. Gerade wenn man beruflich unterwegs ist und sich nicht eifach abseilen kann wenn man keine Lust mehr hat.
Schön, wenn sich berufliche und private Interessen verknüpfen lassen.
So eine alte umfunktionierte Fleischerei gibt es bei uns auch. Das kann ja wirklich nett sein, wenn das gut gemacht ist. Es darf natürlich nicht die Kühle behalten, die man bei Frischfleisch ja doch wertschätzt.
Mit etwas Farbe und ein bisschen Umbau kann man auch Gefängnisse zu Luxuswohnungen machen.
Oder zu Hotels. In Istanbul wurde sogar eines zu einem Four Seasons umgebaut. Hat wahrscheinlich ordentlich Farbe gebraucht.
https://magazine.trivago.de/gefangnis-hotels/
Farbe und die Verlegung der Gitter von drinnen nach draußen.
… Und wäre dieser nachdenkliche Gesichtsausdruck in dem Oben beschriebenen Fall eher traurig oder rein reflektierend?
Da traue ich mir kein Urteil zu.
Wie interessant. Ich denke beim Thema Barock sogar zuallererst an Caravaggio und Rembrandt. Jeder hat bestimmt seine eigenen Assoziationen in der jeweiligen Kunstrichtung, die ihm am nächsten steht.
Ach, mir fiele eher Rubens ein und alles, was ausladend und bauchig ist.
Bei Rubens wirkt ja selbst ausladend einladend. Ein Meister 😉