

Klar, es gibt auch Positives: Zum Beispiel ist es immer schön, wenn es zu einem Bahnhof, zu dem man will, einen direkten Zug gibt von dem Bahnhof, auf dem man steht. So richtig zur Geltung kommt diese Annehmlichkeit dann, wenn man auf dem Bahnhof, auf dem man steht, in den richtigen Zug einsteigt und nicht dumpf denkt: Was kommt, wird gefressen, egal ob Knoblauch oder Vanille. Wählerisch muss man sein, das ist es, was die Charaktere unterscheidet: Der eine Spekulant rollt noch unter dem Potsdamer Platz auf der Rolltreppe, da rollt ein Zug ein, er kann nicht lesen, wohin, aber er hat Wagemut. Er springt auf und hofft, es ist der richtige.
Der andere Spekulant steht auch noch auf der Rolltreppe, als der Zug einfährt, aber er wartet lieber. Der Zug braust ab – Gott sei Dank!, er war nicht drin, sonst wäre er nach Blankenfelde (Kreis Teltow-Fläming) gereist statt nach Zehlendorf. Der Erste saß drin und muss in Yorckstraße schleunigst aussteigen oder er fährt weiter falsch, der Trottel. Bis zum Bankrott in Blankenfelde.
Ich bin der Zweite. Ich ließ den einfahrenden Zug schießen und nahm gleich den Zielführenden: Abstinenz lähmt. Man kann einfach nicht so schnell das Falsche tun. Hätte ich in Glienicke weniger gesoffen, dann wäre ich mir meines linken Fußes jetzt weniger bewusst. Nach dieser Glückssträhne kam der erste Rückschlag: Das Blumengeschäft am Bahnhof Sundgauer Straße hatte vor vier Minuten (19 Uhr) geschlossen. Nebenan beim Gemüse war noch offen, aber eine Wassermelone war mir zu schwer ohne Giuseppe. Wenn ich den ersten Zug genommen hätte und der wäre in die richtige Richtung gefahren, hätte ich es noch gerade geschafft. Ich bin immer so irrsinnig stolz darauf, wenn ich mein Handy nicht bei mir habe, manchmal frage ich mich, ob zu Recht. Dass ich einen Kilometer lang geradeaus gehen musste, war mir klar, in welche Richtung von da an, schon weniger. Wie nützlich ist so ein Handy, bei dem man bloß auf Marina drückt, und sie sagt: nach links. Ich ging auch so nach links: Treffer!
Sommerabend im Garten. Dagi hatte noch so viele Abrechnungen zu machen, bevor sie ihre Praxis am Mittwoch nach dem Urlaub wieder öffnen würde, dass sie in Hamburg geblieben war. Ihre Tochter Valerie ähnelt der Dagi, mit der ich 1967, ’68, ’69 bei ihr, bei uns, in ganz Hamburg zusammen gewesen war, irritierend: im Aussehen und im Agieren. Nicht zum Verwechseln, aber zum Erinnern. Marinas ältester Sohn Sebastian (Basti!) war mit seiner Freundin von Wilmersdorf gekommen; sie leben in einer der beiden Wohnungen, die Florian und Marina sich am Ludwig-Kirch-Platz zugelegt haben: Geldanlage und Alterswohnsitz. Wenn Basti sein Medizinstudium abgeschlossen haben wird, wollen die beiden weg von Berlin, was Dorothee insofern interessiert, als sie irgendwann einmal aufhören möchte, ihre vielen Stufen zu steigen. Am Ludwig-Kirch-Platz winkt ein Fahrstuhl.
Florian hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich bis sieben Uhr eingetroffen sein müsste, falls ich das außereheliche Kind seiner Schwester noch erleben wollte. Da ich mir sowieso einen Zoo-Besuch vorgenommen hatte, war mir die Betrachtung des etwa Vierjährigen nicht sehr wichtig, ich hätte es aber höflich gefunden, rechtzeitig zur Fütterung zu erscheinen. Marina spielte meine Nachlässigkeit herunter: Sie hatte den lebhaften Jungen schon um sechs Uhr ins Bett gebracht, da hatte ich noch mit Dorothee kein Vanille-Eis bekommen. Ich war beruhigt – wegsperren ist besser als schlagen. Auf diese Weise entging mir eine Besonderheit, die ich vielleicht sowieso nicht gesehen hätte: Alle Mongolen erkennt man daran, dass sie einen (Leber-?)Fleck ganz unten am Rücken haben. Da der Vater des Kindes, der nicht Florians Schwager wurde, Tibetaner ist, und da die Tibetaner Mongolen sind, hat der Junge also so einen Fleck. Erst glaubte ich an einen Scherz. Man hat ja bei sich selbst und so vielen anderen Menschen diese Körperstelle nie gesehen, dass man gar nicht wissen kann, was andere Rassen da wohl haben mögen. Wenn Juden ein Kainsmal über dem Gesäß aufwiesen, hätte Himmler sich die ganzen Vermessungen von Becken und Schädeln sparen können. Aber wenn es überhaupt stimmt, dass die Mongolen so etwas besitzen, dann sind sie vermutlich die Einzigen mit derart unverwechselbarem Kennzeichen, und alle anderen müssen sich weiter tätowieren und piercen lassen, um ihre Zugehörigkeit klarzustellen – an welcher Stelle auch immer.
Marina und Florian werden am kommenden Wochenende ihren traditionellen Dänemark-Urlaub antreten und den kleinen Halbtibetaner (Pessimisten sagen: Halbdeutschen) mitnehmen, weil Florians alleinerziehende Schwester ständig unterwegs und mit ihrer Leibesfrucht, gängiger Meinung zufolge, ständig überfordert ist. Also waren wir zu sechst, eine Zahl, die jede Hausfrau freut: Bei sieben fehlt ein Mokkalöffel, und für fünf kocht man auch nicht weniger. Drei, die sagen können, dass sie jung seien, und drei – na ja, sagen kann man vieles.
Die drei ‚Twens‘ könnte man als ‚wohlerzogen‘ bezeichnen, falls man diesen Begriff aus dem Sprachwinkel der Älteren noch benutzte: Sie sagen häufiger ‚geil‘ als ‚Scheiße‘ und helfen beim Tischabräumen. Ihre Gefühls- und Gedankenwelt werden sie mir nicht so ohne Weiteres offenbaren, schon gar nicht im Beisein von Eltern. Und wenn sie es täten, wüsste ich nicht, ob ich sie oder sie mich richtig verstanden haben.
Bin ich zu früh geboren? Wäre ich in der zweitausender Ich-Gesellschaft geborgener gewesen als bei den Achtundsechzigern? Wäre mein altmodisches Pathos heute hipper als damals? Ein freies Berlin statt der Ostweststadt meiner Kindheit und langen Jugend? Als der Paragraf 175 abgeschafft wurde, war ich zweiundzwanzig, als ich das erste Mal von Aids hörte, sechsunddreißig. Dazwischen liegt meine beste Zeit oder genauer: die zwanzig Jahre von 1967 bis 1987, als Roland krank wurde. Oder bis ’91, als er starb; oder bis ’93, als ich von der Deutschen Grammophon wegging. Oder von dem Zeitpunkt bis jetzt. Ob ich unter heutigen Gegebenheiten tapferer für meine Musik und meine Dichtung kämpfen würde, erfolgversprechender? Ich wäre gerne politischer, barmherziger und faszinierender. Mit mitleidloser Teilnahme sehe ich auf die Welt und mich. Abgestumpft. Pergamon, Sex, Obdachlose. Abgestumpft. Wie spitz war ich je?
‚God is a DJ‘. Ja, heute ist der Discjockey Gott. Neulich durfte hier in Berlin der Schriftsteller Thomas Brussig eine Nacht lang den Plattenaufleger spielen. Das würde ich auch gerne, und es würde anderes zu hören geben als die abgemeldete Klischee-Bärme, mit der meine Altersgenossen und die Sender, die sie bedienen, rumätzen. Ich bin eben zum verkehrten Zeitpunkt geboren, wie wir alle. Trotz Käsekuchen, Schlemmerbecher (am Nachmittag) und (bei Tisch) Mineralwasser konnte ich den Mund durchaus vollkriegen. Ich langte beherzt zu und machte aus meinem Herzen die übliche Quasselbude. Ziemlich unsympathisch. Wenn ich kaute, kamen die anderen auch zu Wort, das bin ich meiner Erziehung schuldig, und, auch wie üblich, nutzte Marina diese Pausen am eifrigsten. Familie. In den seltenen Fällen, in denen Schüler und Studenten die Hälfte meiner Gesprächszuhörer bilden, versuche ich möglichst wenig verbal zu beweisen, wie lebenslustig wir Erwachsenen auch mal waren, damit die jungen Menschen nicht denken: Mann, was ’n Grufti! Wie verkalkt ich wirklich bin, geht niemanden was an. Meine Erinnerungen werden nicht wahllos rausgeplappert, sondern liebevoll erfunden und aufgeschrieben.
Die Kinder nahmen mich mit. Nicht nur bis Wilmersdorf. „Das ist doch kein Weg!“, sagte Basti. Er meinte die kurze Strecke zwischen Ku’damm und meinen Linden. Mühelos in zehn Minuten. Und er schmiss mich nicht einfach Friedrichstraße raus, sondern war so fürsorglich, seinen Onkel noch um die Ecke zu bringen.

Titelbild mit Material von A. Savin/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 | auf FB: IngolfBLN/Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 (beide Bildausschnitt)
#2.44 | Versuche, das Leben zu ertragen#2.46 | Architektur der Stadt

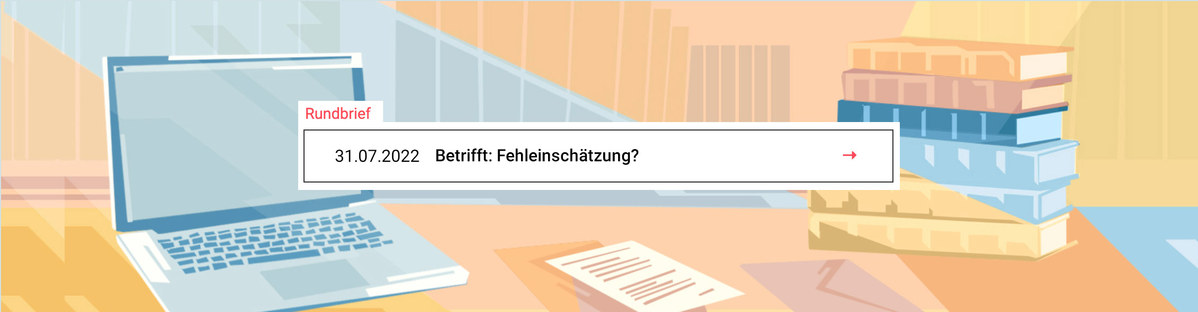







































































Ich traue mich es ja kaum zu sagen, aber Neugeborene betrachten gehört wirklich nicht zu meinen Must-Dos.
Nicht mal in der eigenen Familie? Die Eltern sind natürlich stolz, das kann man ihnen kaum absprechen. Um fremde Kinder muss man sich ja in der Regel nicht groß kümmern.
Ich finde Babys grässlich. Dafür bin ich ein großer Fan von Erwachsenen.
hahaha
Politischer wäre ich auch gerne. Ich verfolge das Geschehen zwar überaus interessiert, aber ich bin ausgenommen der Wahlen doch selten dazu geneigt einzugreifen.
Was hält Sie ab? Die eigene Faulheit oder doch die fehlende Dringlichkeit?
Ich hatte auch immer mehr Meinung als Mitmachwillen. Man kann nicht überall gut sein. Ich hatte mir ein anderes Feld gewählt – oder das Feld sich mich.
Jeder muss eben tun was er oder sie kann. Alles andere bringt eh nichts.
„God is a DJ“ haben ja sowohl Faithless in den 90ern wie auch Pink irgendwann später in den 2000ern ausgerufen. Schon ein komischer Gedanke, aber immerhin positiver als „Gott ist tot“.
Es soll ja wohl auch nur heißen, dass man das Beste aus dem Leben machen muss. Im Pop klingt das zwar ein wenig blöder, aber es kommt doch aufs Gleiche hinaus.
Ich erinnere mich noch 1982 in New York zum CSD an das Schild: ‚God is gay and I am the gay Messiah‘. Kurz danach hat Gott sich dann aber anders entschieden und Aids gesandt.
Und nun schickt er Corona und die Affenpocken hinterher um die letzten Querdenker auszurotten. Ob es der Menschheit auf lange Sicht helfen wird?
Vielleicht. A b e r der G l a u b e steht dem im Wege.
Hahaha, der letzte Satz! 😆
Und das ohne Erbschaftszusage.
Anfängerfehler
Der richtige Zug sollte es schon sein. Und vor allem hilft es dann, wenn man in die richtige Richtung fährt.
Der richtige Zug in entgegengesetzter Richtung ist schlimmer als der falsche mit leichter Abweichung.
Das kommt natürlich ganz darauf an wer drin sitzt 😉
… und wem man aufsitzt.
Wer Thomas Brussig als DJ aufgesessen ist, der wurde jedenfalls ordentlich übers Ohr gehauen.
Ein Ohrwurm findet sich immer.
Ha! Die Erinnerungen werden also liebevoll erfunden. Das ist bestimmt wahrer als man beim ersten Lesen denken würde.
Also, bei meinen Reiseberichten bin ich immer ehrlich. Die Wahrheit ist komisch genug.
Oft ist das wahre Leben tatsächlich absurder als alles, was man sich ausdenken könnte. Dass man die Erinnerungen im Nachhinein ausschmückt, glaube ich aber trotzdem. Was da schon nervenaufreibend war wird nochmal dramatischer, was im Moment komisch war wird zur großen Pointe.
Das Gehirn wäre wahrscheinlich auch total überfordert, wenn man da alle Nuancen abspeichern würde.