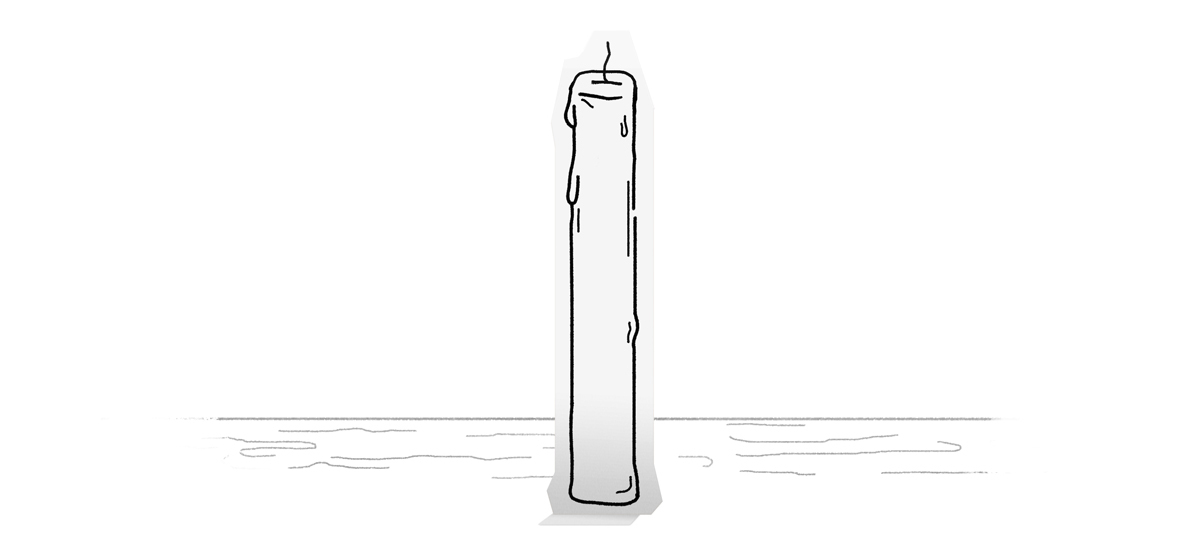

Versonnen saßen wir auf der Holzbank und blickten, nicht minder versonnen, auf die Uferböschung der Pfaueninsel und auf die Fähre, deren Zwei-Mann-Besatzung sich offenbar eine längere Verschnaufpause gönnte. Die Bank war recht hart, ich hatte das Gefühl, eine Toilette wäre jetzt nicht schlecht. Ich hörte von Ferne die Pfauen ungeduldig krächzen, das Gestade der Insel war nicht weiter als zwanzig Meter entfernt. Andere Ausflügler fanden den Weg zur Anlegestelle. In einem Kiosk hielt eine Frau mittleren Alters Knackwürste und Jägermeister feil. Sie wartete mit verschränkten Armen. Linde strich der Wind durch die Weiden, als kämme er behutsam ihre Zweige. Die Fährmänner hatten sich viel zu erzählen und keinen Fahrplan. Wo mag die Frau mit dem Magenbitter hingehen, wenn die mal aufs Klo muss? Giuseppe stand auf und machte ein paar ziellose Schritte; vielleicht genoss er es, langsam gehen zu dürfen. Zwei Schwäne zogen vorbei, mit arrogant gestreckten Hälsen, ohne die beiden Ufer rechts und links zu beachten und in fast schon aufsässiger Gelassenheit. Eine Wolke schob sich gemächlich vor die Sonne. In unserem ersten gemeinsamen Frühling, 1976, habe ich Roland zusammen mit einem Rad schlagenden Pfau gefilmt. In einem der Kartons auf dem Garagenregal liegt die Kamera. Der Film ist noch nicht digitalisiert, ich habe ihn Ingrid, Bo und Giuseppe an unserem vorletzten Abend in Hamburg gezeigt. Giuseppe setzt sich wieder, die Fähre setzt sich in Bewegung. Die Wolke gibt die Sonne frei, ihr Licht schwingt auf den braunen Wellen.
Es ist heiß geworden. Die Insel wirkt naturbelassen, also verwahrlost. Baumansammlungen, zu klein für einen Wald; Lichtungen, zu klein für eine Wiese. Der Boden ist hügelig. Zwei Arbeiter kommen uns entgegen, was die wohl machen? Gärtner können es nicht sein. Als sie hinter der Hügelkuppe verschwunden sind, kann ich nicht länger widerstehen: Das Gebüsch ruft. Ich hoffe, Giuseppe denkt, ich will bloß pinkeln. Gott sei Dank habe ich noch die Eintrittskarten vom ‚Planet Hollywood‘ in der Hosentasche …
„Pfau-en-in-sel?“, fragt Giuseppe. – „Si“, bestätige ich. In der Ferne steht der weiße Turm im Gras. Ich will da nicht hin; ich fürchte, dass es schmerzlich wäre. Erinnerung ist selten lustig.
Wir gehen in weitem Bogen zur Anlegestelle zurück. Auf einem Zweig sitzt ein weißer Pfau. Na, immerhin. Dann war der Ausflug auf die Insel ja nicht ganz umsonst, auch wenn vorne blau und hinten weitschweifig eindrucksvoller wäre. Nicht in der eigenen Wohnung, aber in der Natur.
Wir fahren die Königstraße herunter. Kurz vor der Glienicker Brücke führt der Privatweg zum Schloss. Die Auffahrt verheißt ein Lokal. Und wirklich! Das ist neu. Im Schloss ein Restaurant mit runden Tischen und hohen Stühlen, menschenleer. Wir kreuzen den Saal; an der Terrassentür grüßt der Kellner mit eleganter Routine. Weiß gedeckte Tische, breite Sonnenschirme, ein paar ruhige Menschen sprechen, nicken und essen. Jenseits der Buchsbaumhecke Gras, ringsum hohe Bäume. So habe ich mir das vorgestellt.
„Bitte sehr!“, sagt der Kellner und zeigt in die Richtung meines Blickes, „der Tisch ist für Sie.“ Und das ohne Vorbestellung! Alles hier mag ich: Giuseppe, den Sommer, den Park, die Terrasse, die Idee, bedient zu werden: selbstverständlich und zuvorkommend; das Geschirr, auf dem sich die Sonne spiegelt; die Menschen, die unaufdringlich ein Gefühl von Geselligkeit verbreiten. Nur ich störe – meine Appetitlosigkeit, meine Gedankenschwere, meine Rastlosigkeit.
„Die Weinkarte?“, fragt der Kellner hoffnungsfroh. – „Ja“, sage ich bestimmt. Gerichte auswählen macht Spaß; schlimm ist nur, dass sie dann auch kommen. Ich liebe Hunger und Verstopfung, eine unerfüllte Liebe, in beiden Fällen.
Rotwein ist besser für den Magen als Weißwein. Vielleicht wäre kein Wein auch nicht schlecht für den Magen, aber dann kann ich nicht essen, und das kann ich Giuseppe nicht antun. Die Vorspeise kommt, das geht noch, aber dann kommt das Hauptgericht, das geht nicht mehr. Giuseppe nimmt die Gabel, und die Vögel gehen leer aus.
Pfau wurde in der Antike gern gegessen. Schmeckt sicher ähnlich wie Fasan. Bei den Kerlen täte es einem ja leid, aber die Weibchen sind unscheinbar genug, um mitleidslos im Ofen zu landen. Unter den Menschen sind ja eher die Frauen aufgedonnert. Sagt man ihnen, dass man ihre Aufmachung bemerkt hat, sind sie neuerdings beleidigt. Merkt ‚Mann‘ es nicht, erst recht.
Nun bin ich doch ein bisschen beschwingt: Der Sonnenschein und nicht essen zu müssen! Wir führen unser Gespräch weiter, während wir zur Mauer gehen, an der der Park endet. Auf unserer Seite ist die Mauer höchstens fünfzig Zentimeter hoch, ihre Ecke bildet einen kleinen Pavillon mit Dach und zwei Fenstern: Von dort aus führt der Weg am Schloss vorbei zu unserem Wagen. Auf der anderen Seite fällt die Mauer zwei Meter ab zur Straße, und jenseits der Straße führt die Glienicker Brücke über die Havel nach Potsdam. Das tat sie 1976 nicht. Damals habe ich Roland vor dem gelben Ortsschild ‚Berlin‘ gefilmt, mit der Brücke und der DDR-Fahne im Hintergrund. Mit Roland die Brücke im Herbst 1990 zu überschreiten, hatte sich nicht mehr erzwingen lassen. Er war schon zu schwach für die Berlin-Reise gewesen, und so hat er nicht mehr erlebt, dass die Brücke wieder nach Potsdam führte, schrankenlos. Nun hatten wir nie etwas in Potsdam verloren, und so geht die Symbolik etwas ins Leere. Der Reiz bestand in wenig mehr als in der Unmöglichkeit. Trotzdem bleibt die Brücke eine merkwürdige Stelle: Zu beiden Seiten ist die Havel breit, sie bildet rechts den Jungfernsee, der ab der Mitte zu Brandenburg gehört, und links den Tiefensee, der ganz zu Brandenburg gehört. Anders als in der Stadt, wo Straßen willkürlich zugemauert wurden, ist hier dieses Nadelöhr tatsächlich die einzige Verbindung von Berlin zu seinem Umland.
Ich starrte die Mauer herab und sprang. In Fernsehspielen springen nicht nur Mörder, sondern auch Hauptkommissare auf Verfolgungsjagden problemlos von solcher Höhe in die Tiefe und rennen gleich weiter, sodass die Kamera mitschwenken muss. Ich fühlte mich wie in den Boden gerammt. Giuseppe hangelte sich unsportlich an der Mauer herunter. Im Fernsehen hätte man die Szene doubeln oder herausschneiden müssen. Auf der anderen Seite taten Giuseppe die Knöchel bestimmt weniger weh als mir. Auch in meiner Bubenzeit, in der ich häufiger als heute irgendwo runtergesprungen bin, obwohl ich mir damals keinen Mut mit Rotwein antrank, hat das Aufkommen unten nie Schmerzen verursacht. Tapfer lief ich auf die Brücke zu, ich wollte meinen Auftritt nicht verpatzen.
Auf der Mitte der Brücke hatte man einen herrlichen Blick auf Schloss Babelsberg, und ich erklärte Giuseppe unermüdlich, dass man zu DDR-Zeiten weder auf die Brücke gekonnt hatte noch ins Schloss Babelsberg. Ich dagegen hatte mehr Schwierigkeiten, von der Brücke wieder runterzukommen. Aber da soll man sich nicht so anstellen, wir liefen noch zum Jagdschloss Glienicke, bevor wir zum Auto zurückkehrten und dann mit dem Wagen über die Brücke nach – Gott behüte! – Potsdam fuhren, wo auch gleich die frisch gestrichenen Villen der Berliner Vorstadt begannen. Potsdam erschlossen wir uns vom Seitenfenster aus. Für Sanssouci reichte die Zeit sowieso nicht, da konnte man die Breite Straße, die Russische Kolonie und den Cecilienhof auch im Vorbeifahren abhaken und gleich weiterfahren nach Sacrow.
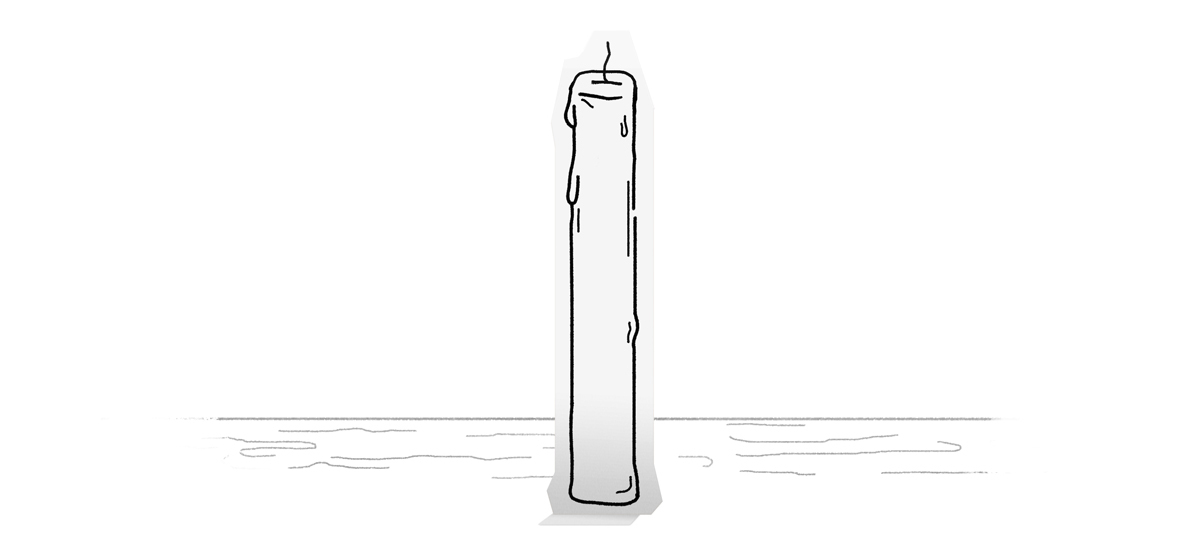
Titelgrafik mit Material von: Times/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (Schloss Babelsberg), Sören Kusch/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (Jagdschloss Glienicke), Klaus Bärwinkel/Wikimedia Commons, CC BY 3.0 (Pfaueninsel mit Schloss), Sunti/Shutterstock (Pfau)









































































Gerichte auswählen macht auf alle Fälle Spaß. Ich bin nur manchmal enttäuscht was dann nachher auf dem Teller liegt.
Die Frage bleibt dann immer ob man es selber besser könnte oder ob man trotzdem im Restaurant besser aufgehoben ist.
Ich bestelle möglichst Gerichte, die ich selbst nicht zubereiten könnte. Das schließt Enttäuschungen nicht aus, ist aber lehrreicher.
Ansonsten hat man auch immer ein wenig das Gefühl man hätte genauso gut zuhause bleiben können.
Am Ende bestelle ich aber doch immer die gleichen Sachen. Vielleciht sollte ich mal experimentierfreudiger werden 😝
Wenn man aber nicht erraten kann, um welches Kraut, Tier oder Organ es sich handelt, fragt man besser noch mal nach.
À la Molekularküche. Das ist mir dann doch etwas suspekt. Da kann ich mit viel Wohlwollen das Geschick wertschätzen, aber selten das Geschmackserilebnis.
Man kann über nichts so gut streiten wie über Geschmack.
Mit Potsdam bin ich auch nie richtig warm geworden.
Sanssouci lohnt sich aber meiner Meinung nach schon wenn man mal in der Gegend ist. Man kann vieles andere ja auch auslassen.
Zum ersten Mal war ich 1987 da: Es war furchtbar. Seither hat sich Potsdam Jahr für Jahr verbessert. Die Parks, die Gassen – jetzt gefällt es mir (für einen Tagesausflug).
Ich finde es auch ganz hübsch. Man muss ja keine ganze Woche dort bleiben. Aber für einen Nachmittag ist es schon nett.
Wobei ein gemeineres Urteil als ’nett‘ schwer denkbar ist.
Im Zeitalter der Superlative kommt „nett“ eben nicht mehr mit. Aber es kann ja deswegen auch nicht alles und jedes das Beste, die Nummer 1, unfassbar, nicht zu verpassen und iconic sein.
Der Superlativ ist inflationär, ganz bestimmt, aber ’nett‘ ist so unbestimmt, dass man es kaum noch wahrnimmt. Möchte man einen netten Film sehen? Schon Spitzweg war mehr ironisch als nett, bilden wir uns heute ein.
Ich war noch nicht dort, aber die Pfaueninsel macht einen wirklich hübschen Eindruck. Ich hatte eben Bilder gegoogelt. Immer wieder gut, über solche Orte zu lesen.
Möglichst nicht am Wochenende besuchen!
Ah ja, der Tip gilt ja für die meisten schönen Orte.
Naturbelassen ist doch nicht gleich verwahrlost. Das passt doch höchstens bei Parks oder Gärten, also etwas künstlichem, dass man auf einmal nicht mehr pflegt. Die Natur selbst sieht doch nie wirklich verwahrlost aus.
Die Pfaueninsel ist doch ein Park mit Schlösschen.
Ich hasse Hunger leidenschaftlich. Meine Freunde würden mich wahrscheinlich als ziemlich unausstehlich beschreiben wann immer ich ernsthaft hungrig werde.
Ich wüsste auch von Niemandem, der Hunger genießen würde. Appetit ist natürlich eine ganz andere Sache, aber richtig hungrig zu sein ist schon eher eine Qual als eine Freude.
Es ist natürlich etwas masochistisch…
Hunger kenne ich wohl nicht. Appetit habe ich gern, vor allem, wenn ich weiß: bald kommt das Essen. Sattsein und essen sollen (ich als Kind) ist ähnlich quälend wie hungern, denke ich.
gegen den eigenen willen gefüttert zu werden klingt in der tat nach folter
Der Titel ist ja mal wieder toll! „Sprung ins Diesseits“ ist ja so poetisch und bilderreich.
Und in diesem Fall ziemlich schmerzhaft.
Ja das gehört manchmal dazu.
Ein Freund hat sich bei sowas mal die Achillessehne gerissen. Es geht also noch ein Stückchen schlimmer 😉
Schlimmer geht’s immer. Kurz bevor man ertrinkt, kann einem noch die Möwe ins Gesicht kacken.
In Fernsehserien und Filmen sieht es immer so aus, als bekämen die Kommissare regelmäßiges Parcour-Training. Ob das bei den entsprechenden Figuren glaubwürdig wäre, naja.
Alles was erfunden wird kommt im Kino besser rüber als einfach die Realität zu zeigen. Meistens jedenfalls. Deshalb sind doch Thriller auch die größeren Kassenmagneten als Dokumentationen.
Wobei mittlerweile ja fast ausschließlich die riesigen Blockbuster von Marvel, James Bond, Herr der Ringe etc. an der Kasse funktionieren. Das Programmkino leidet doch sehr.
Alte, weiße Kulturkritiker würden sagen: „Das Volk lässt sich von äußerer Spannung mehr beeindrucken als von innerer. Glotzen macht mehr Spaß als denken. Und das seit dem Altertum.“
Ich sehe ja immer wieder Artikel, Podcasts, Bücher, die fragen ob das Kino im Streamingzeitalter noch überleben kann. Vielleicht müsste man die Frage spezieller auf Indiefilme gerichtet sehen. Diese Blockbuster werden doch immer eine Chance haben.
Das Gemeinschaftsgefühl, das ich beim Musikhören nicht vermisse, treibt wohl doch noch viele in die Kinos und in die Fußball-Stadien. Wenn wir uns allerdings erst 3D-Brillen aufsetzen und dann mitten in der Prärie stehen, dann verzichtet man vermutlich ganz gern auf einen Popcorn-Mampfer auf dem Nachbarsitz.
Dass in den letzten Monaten der Nachbarplatz aus Sicherheitsgründen frei blieb war mir ehrlich gesagt sehr angenehm.
Als Kinokunde stimme ich zu, aber die Betreiber sahen das bestimmt etwas anders. Selbst die großen Cineplex-Kinos müssen ja ihre Miete bezahlen.