

Montag, 24. Juli
In fünf Monaten ist Weihnachten, und heute hat mein Freund Herbert Geburtstag. Ich beglückwünsche seinen Anrufbeantworter und schlafe weiter. Nichtstun ist nun mal meine Lieblingsbeschäftigung. Aus ihr heraus erwachsen Träume und Ideen, oder sie lassen es bleiben. Nur muss das Nichtstun rechtzeitig trainiert werden, im Alter gelingt es sonst nicht mehr. Da stellt sich dann sofort, wie abgerufen, ‚das schlechte Gewissen‘ ein, das einem gleich anschließend an die Muttermilch eingetrichtert wurde. Wenn man es sich in jungen Jahren so richtig gemütlich machen wollte (in sich oder an sich), dann salutierte es mit zusammengeschlagenen Hacken: Schlechtes Gewissen meldet sich gehorsamst zur Stelle und wartet auf Dero Erbärmlichkeit Befehle! Nüchterne kuschten dann, Sinnlichere dachten sich nach und nach immer bizarrere Strafen aus. Die Strafverfolgungsjagden machten sie allmählich zum Inhalt ihres Lebens – bis sie erst die anderen und dann sich selbst zur Strecke gebracht haben: sado, maso, morto.
Vielleicht ist es auch – bei allem Lob des Nichtstuns – ein Unterschied, ob man, wenn man es nur wollte, im nächsten Augenblick aufspringen und die Welt erobern oder zumindest an sich heranlassen könnte – oder ob man, ans Bett gefesselt, zum Nichtstun verdammt ist.
Guntram rief an: „Es geht hier nicht mehr. Wenn du da in Ausstellungen rennst, dann kannst du ja auch zurückkommen.“
Ich blieb liegen. Wie er. Er liegt, gefesselt in sich selbst, und grübelt: ‚Warum ausgerechnet ich?‘ Warum ausgerechnet er nicht? Er hat nie gelernt, mit Abstand zu denken: aus sich heraus, in sich zurück. Von sich absehen zu können, ist das Einzige, was hilft, und es ist, wie Glauben, eine Gnade. Wenn der Glaube versagt, weil sich die Idee, das Leben solle vor allem Gott gefällig sein, hartnäckig verweigert, dann kann man sich dennoch einer ‚gewissen‘ Humanität verpflichtet fühlen, warum auch immer. Aber im Wesentlichen geht es dann um zweierlei: Erkenntnis sammeln oder Lust und Geld verdienen, um beides zu ermöglichen. Die Großstädte sind Zentrum der Lust und der Erkenntnis, das überschneidet sich: Ein Museums-, Konzert-, Filmbesuch soll beides sein. Darum ‚rennt‘ man ja in Ausstellungen, und dasselbe gilt für einen Lokal-Termin. Auf der Speisekarte steht ‚Hühnchen mit Zimt‘. Na, so was! Wenn es mir schmeckt: Lust und Erkenntnis. Hmmm! Und aha!
Großstädte sind auch die Zentren des Geldverdienens. Geldverdienen als Selbstzweck. Auch eine Lust? Weil es Selbstwertgefühl schafft? Manchmal ist da nur ein Loch, man stopft hinein und hinein. Viel Geld, wenig Selbstgefühl. Tipp des Tages: Nudeln mit Kartoffeln und Reis. Die Stadt, Berlin, das Leben – eine einzige große Sättigungsbeilage, an der man verhungert. Gebet, so wird euch gegeben werden? Weitermachen, ohne sicher zu sein, dass etwas bleibt. Berlin hat immer wieder von vorne angefangen; eine Stadt, die sich gewaschen hat – ist Berlin einfältig?
Unglück hat jeder, aber was macht man draus? Nicht die Verzweiflung ist wichtig, sondern wie man sie beschreibt.
Ich stoße mich aus dem Bett an den Schreibtisch. Drei Sätze, das Telefon klingelt. Irene war in dem Pflegeheim des Arbeiter-Samariter-Bundes. Es sei dort einfach zu schrecklich, sagt sie. Man könne die drei Wochen, die sie und ich nach Meran fahren wollten, Guntram das als Unterkunft nicht zumuten. Ich sehe das ein, aber keinen Ausweg. Das Haus in Meran wird nicht zusammenbrechen, wenn Irene es nicht nach zwei unbesuchten Jahren endlich wieder durch ihre Anwesenheit erfreut. Irene wird zusammenbrechen.
Ich rufe Roemmelt an. Wir verabreden, dass Guntram ins Krankenhaus soll, damit Irene ins Krankenhaus kann. Er zum Aufpäppeln, sie zu Herzuntersuchungen. Ich führe eine Reihe von Telefongesprächen – neun Zehntel allen Glücks …
Es stimmt nicht ganz, dass die beiden großen Kinos am Potsdamer Platz dasselbe Programm haben. ‚Sonnenallee‘ gibt es nur in dem, vor dem ich nicht mit Dorothee verabredet bin. Das merke ich natürlich erst, als ich nach einigem Anstehen die Karten kaufen will. Ich bin spät dran und kenne ihre Aufgescheuchtheit. Hoffentlich werden wir uns überhaupt finden! Ich renne noch einmal durch die falsche Halle und haste dann über die Potsdamer Straße zum Mercedes-Center. Dorothee kommt mir gänzlich unaufgeregt entgegen: „Is’ doch hier“, sagt sie zufrieden. Der Film wird zwar am Donnerstag abgesetzt, aber für mich ist es vorher eine Dreifach-Premiere: zum ersten Mal im CinemaxX, zum ersten Mal um Viertel nach drei (15 Uhr 15) im Kino, und eben der Film selbst. Dorothee und ich besuchten die Vorstellung aus ähnlichen Beweggründen: sie, um den Osten zu lieben, ich, um ihn zu hassen. Folgerichtig fand sie ihn zu schrecklich dargestellt, ich fand ihn zu niedlich.
Bei einem Thema, das örtlich, zeitlich und mir so naheliegt, verstehe ich keinen Spaß: Der Abstand ist einfach nicht da. Über die Jungfrau von Orleans und Maria Stuart kann ich lachen, hier nicht. Da wird ein Film als ‚herausragender Spielfilm‘ ausgezeichnet, in dem die Straßenbahn direkt an der Mauer entlangfährt, auf die – im Osten! – gekritzelt ist: ‚Rolling Stones‘. Todesstreifen? Militärisches Sperrgebiet? – I wo!, der Hauptdarsteller spielt da Ball und knutscht da rum, als sei’s an der Krummen Lanke. Eigentlich passt sich die Mauer architektonisch befriedigend den anderen Ost-Bauwerken an. Den Westen kriegt man nicht zu sehen. Nur die paar abgetakelten Arbeiterhäuser eines runtergekommenen Stadtbezirks, in dem die Protagonisten rumpubertieren. Die Mauer hat richtig was Gemütliches, da gibt’s wenigstens keinen Durchgangsverkehr: Die Straßenbahn muss um die Kurve. Dass es bei Spießern zu Hause spießig aussieht, wird aber offenbar nach wie vor als komisch empfunden, wie man ja auch täglich in TV-Soaps, inklusive Lacheinblendungen, miterleben kann. – Was noch? – Ein paar Wortwitze, nicht alle DDR-spezifisch. Eine wüste Party – so was Ähnliches lief bei mir zu Hause 1963 auch mal ab, als meine Eltern verreist waren und ich mich bei meiner Klasse auf andere Weise beliebt machen wollte als in der Grundschule beim Zeichenunterricht. Zumindest demonstrierte diese Sause das Systemübergreifende jugendlicher Ausgelassenheit. Bleibt als größtes Plus des Films die Sehnsucht nach einer Musik, die man laut Staatsmacht nicht haben sollte. Lebensgefühl als Auflehnung. Mick Jagger kontra FDJ. Das geht in Ordnung, und da muss ich aufpassen, diesen Sog nicht unterzubewerten, denn die Ost-Bubis verzehrten sich nach genau der Musik, die ich an jeder Ecke haben konnte und nicht brauchte. Ansonsten: War halt nicht Satire, sondern mit all seinen Ungezogenheiten ein braves Lustspiel, ein ganz nettes, dem ich gar nicht so viel Tadel schenken würde, wenn es nicht so viel Lob geerntet hätte. Dorothee fasste das, als wir wieder in den Nachmittag hinaustraten, auf ihre unnachahmliche Art zusammen: „Nein, der Film war gut. Doch.“
Wenn schon Premiere, denn schon Premiere! Wir setzten uns da, wo man von keinem Selbstbedienungsterror in die Schlange gezwungen wurde, an ein zierliches Tischchen und bestellten jeder ein Stück Kuchen. Das war für mich so exotisch, wie es für Teilnehmerinnen eines Kaffeekränzchens wäre, nachts um eins das zu treiben, was ich dann so machte. Noch komischer hätte ich es gefunden, einen Becher Eis zu essen. Das taten wir anschließend. Zur Abwechslung nicht mehr bei Mercedes, sondern einen Designer-Platz weiter, bei Sony. Ich sah mich um: Machten alle einen ziemlich normalen Eindruck, die Leute, die sich auf einen Stuhl setzen und Eis essen: T-Shirt, Bluse, Poloshirt, Jeanshemd; bunte, busenlose Frauen, bunte Männer mit Brüsten überm Bauch. Das also ist es, was du nachmittags auf einem Platz machst, wenn du keinen Wein willst und ‚Leoparden küsst man nicht‘ und ‚Jurassic Park‘ für dich die Dino-Szene hinlänglich abgedeckt haben: abwarten und Eis lecken.
Allerdings, auf uns bezogen: Sehr viel Zeit hatte ich gar nicht mehr, und Dorothee wollte schon auf der Grenze zwischen Mercedes und Sony nichts als – Kindheitserinnerungen? – Vanille-Eis.
„Is’ heute aus“, leichte Genervtheit in der Stimme des Typen, der hier jobbt. So, genau so, ist nicht nur das Leben, nein, so ist die ganze Freizeit: Erst guckst du an einem der wenigen Sonnennachmittage dieses Sommers in einem schwer zu findenden, finsteren Kino einen Film, der ‚Sonnenallee‘ heißt und für den du, streng genommen, auch nicht in die Nachtvorstellung hättest gehen müssen, dann zerkleinerst du Obstkuchen mit zu dickem Boden, wobei du wegen Sonneneinstrahlungen, die Dorothee abträglich sind, erstens den Platz und dann den Tisch wechseln musst, und danach lutschst du Mango- und Pistazieneis, weil kein anderer Idiot diese geschmacksneutralen Sorten nimmt, und du schielst nach der Uhr, um rechtzeitig bei deiner Cousine zu sein, bei der du gnadenlos wirst essen müssen, weshalb du dir geschworen hattest, bis zum Abend nichts Essbares anzurühren. Du spürst die Sahne am Gaumen schmelzen, du schließt die Augen und du sagst dir: ‚Genieß es, Junge, das kommt nie wieder!‘
„Schmeckt doch gut, nicht?“, forderte Dorothee. Du nickst versonnen, und sie wird sagen: „Ach, dann nimm doch noch ’ne Kugel von mir! Ich schaff’ das nicht.“
Und da sollst du dir nicht verarscht vorkommen? Nein. Zu meiner Zeit wurde man noch dezenter ‚veräppelt‘. Mit Mango klappt das jetzt eben nicht mehr.

Titelbild mit Material von Lienhard Schulz/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (Straßenschild, Ausschnitt), Srittau/Wikimedia Commons, CC0 1.0/public domain (Straßenmast, Ausschnitt)

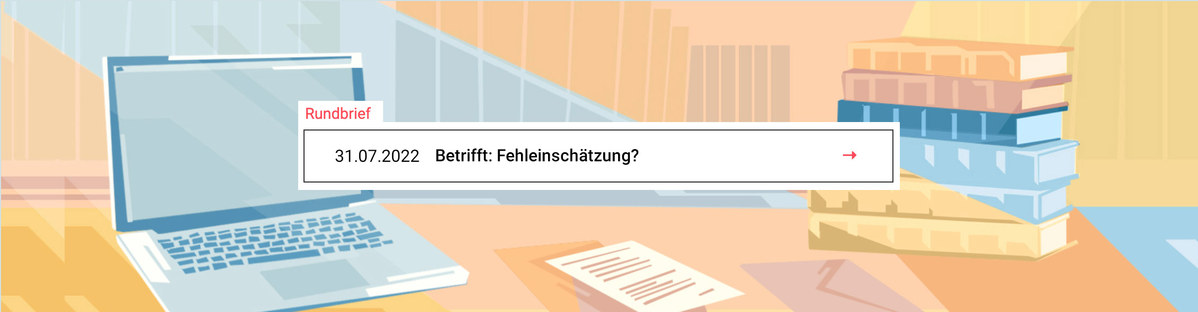







































































Ich finde es doch immer wieder interessant, dass jemand, der so viel Lebensfreude, Begeisterungsfähigkeit und Kreativität besitzt wie Sie es tun, so wiederkehrend über die Schwierigkeit das Leben zu ertragen, schreibt.
Das eine ist Kompensation für das andere?
Eigentlich lebe ich gern, vor allem, um zu schildern, was ich denke und erlebe. Aber die (Un)möglichkeit, nicht geboren zu sein, finde ich auch sehr reizvoll. Gerade deshalb spüre ich die Verpflichtung, das Beste für alle daraus zu machen, dass es mich nun mal gibt.
Unterschiedliche Sichtweisen über das Leben – es gibt wenig interessanteres.
Nichtstun liegt mir gar nichts. Mir wird immer viel zu schnell langweilig wenn ich nichts zu tun habe.
Das ging mir früher ähnlich. Allerdings fielen mir schon immer gleich Geschichten ein, die mich beschäftigten.
Hmm, wie definiert man denn für Sie ‚Nichtstun‘, Colin? Gar nichts tun ist natürlich öde, aber wenn man z.B. auch meint mit einem Buch im Park zu sitzen oder zu schreiben, das macht mir schon viel Freude.
Beschäftigung kann viel langweiliger sein als Muße.
Ich habe immer im Kopf, dass Daniel Brühl in Sonnenallee mitspielt. Womit verwechsle ich das nochmal?
Good Bye Lenin! Ungefähr dieselbe Zeit 😉
Aber ein viel besserer Film!
Ich erinnere mich an beide kaum…
Heutzutage ja alles jederzeit abrufbar.
Umso ärgerlicher finde ich es immer, wenn der Film, den man unbedingt schauen möchte, doch nicht aufzufinden ist. Und das, wo ich mit Netflix, Amazon Prime und MUBI ja schon mehr als ausreichend abgedeckt bin.
Beide Filme sind bei Amazon prime zu besichtigen.
„Wenn schon, denn schon“ ist eines meiner meistzitierten Mottos 😉
Die Schwelle zwischen Zuversicht und Übertreibung.
Braves Lustspiel klingt ja sehr nach deutschem Film. Daran hat sich immer noch nicht wirklich viel geändert.
Kein Christian Petzold oder Maria Schrader Fan?
In der Kathegorie ‚Lustspiel nicht so zuhause.
Berlin wird von außen immer ein wenig anders betrachtet als von den ‚Locals‘. Das ist doch auch gar nicht überraschend. Wenn die Münchner von Berlin begeistert wären, dann wären sie ja Berliner.
Umgekehrt fand ich, außer bei Paris, die Städte immer interessanter, wenn ich sie besuchte, als wenn ich in ihnen lebte.
Bei vielen geht mir das auch so.