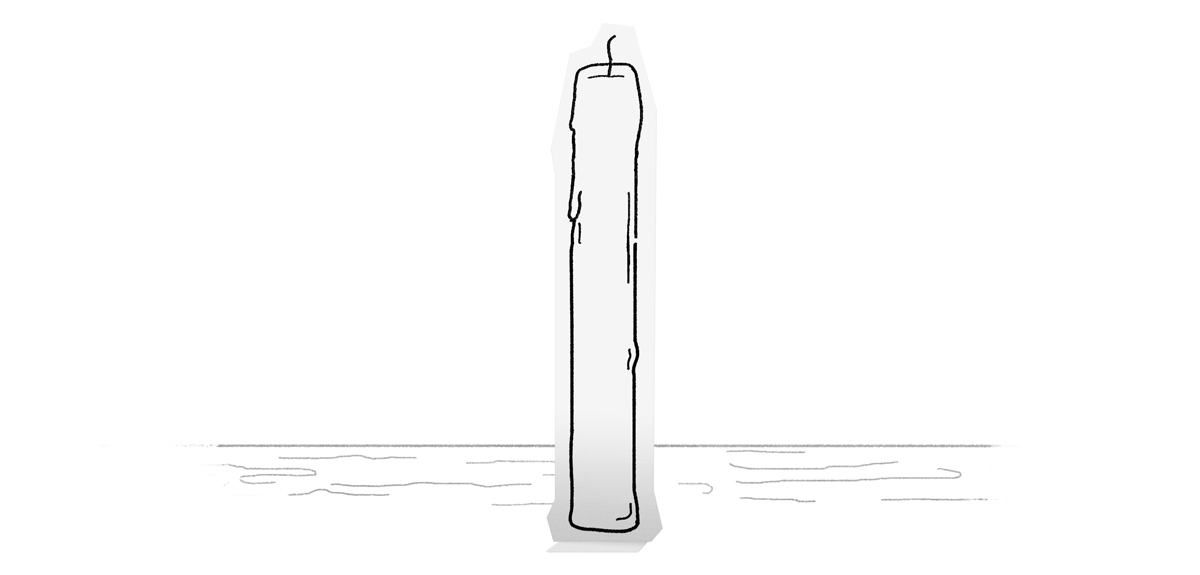

Mittwoch, 5. Juli
Wenn es mir schlecht geht, habe ich einen Widerwillen gegen alles, was mich an die Welt bindet: Telefongespräche, E-Mail-Schreiben, Termine vor Ort. Anderen dienen gerade solche Bindeglieder als Rettungsringe. Mein Anker ist mein Bett. Auch wenn ich Schiffe nicht zeichnen kann, verstehe ich doch was von Häfen. Fest vertäut am Pier liegen und glaubhaft die hohe See zu schildern – das ist das Ideal des Schummlers. E-Mail ist so ein Zwischending zwischen Telefon und Brief. Nicht so präzise wie der Brief, aber auch nicht so luftig wie das gesprochene Wort. Eine eigene Ausdrucksform, die meiner Methodik von spontaner Planung und geplanter Spontaneität sehr entgegenkommt. Volker Eckhoff1 hatte mir einen neuen PC extra e-mail-mäßig eingerichtet, aber der Anschluss funktionierte nicht in meinem Appartement. Selbst der gescheite Bo brachte die Leitung nicht zum Funktionieren, was mein Unvermögen rehabilitierte. Ich hatte meine Schwierigkeit an der Rezeption geschildert, und man hatte mir einen Fachmann versprochen.
Der Fachmann kam nicht. Es ging mir schlecht und so vermisste ich keine Kommunikation. Die, die ich hatte, reichte mir: ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ein Ärgernis im Aufwachen, aber wenn man erst mal wach ist, freut man sich doch.
Heute ist nicht die leere Hälfte des Bettes der Maßstab, sondern die Uhr. Um halb eins ist der Termin. Vor halb zwölf stehe ich nicht auf. Giuseppe sagt, er gehe um den Block. Giuseppe ist wieder da. Es hilft nichts. Ich muss. Mir hilft Giuseppe.
Professor Büchsel betreut nicht nur Magenkranke im Westend, sondern leitet gleichzeitig die entsprechende Abteilung im DRK-(Deutsches Rotes Kreuz)-Krankenhaus im Wedding. Westend ist feiner, Wedding ist näher. Aber auch wieder nicht so nahe, wie ich dachte. Auf dem Stadtplan sieht es so aus, als müsse man die Friedrichstraße nur geradeaus fahren, bis sie erst Chaussee- und dann Müllerstraße heißt, dann rechts abbiegen, im Bogen fahren und dann wieder rechts abbiegen, schon sei man in der Osloer Straße und da.
Die Friedrichstraße, die ich am Wochenende bereits wegen ihrer Ausgestorbenheit bedauert hatte, war prall: Transporter, Zementmischer, Lastkraftwagen. Berlin baut. Jedenfalls an Wochentagen. Am Sonntag geht es natürlich flotter. Wenn nicht gespielt wird, sind auch Stadien leer. Sogar Waterloo, als ich da mal war. Um zwölf Uhr verließen wir die Garage. Bis wir die Linden gekreuzt hatten, waren bereits zehn Minuten vergangen. Jetzt würde es glattgehen. Von wegen! Gleich in den nächsten Stau am Bahnhof. Nach einer Weile merke ich, woran es liegt: Die Ampel, an der es ganz harmlos zur Torstraße (früher Wilhelm-Pieck-Straße) abgeht, ist nur zehn Sekunden lang grün, da kommt gerade mal ein Stahlträger auf Rädern durch. Zehn vor halb eins. Ich bin wie gerädert. Es geht mir doch mies genug, musste ich mich auch noch unter diesen strafverschärfenden Zeitdruck bringen!
Nach der Torstraße wird es nicht besser. Giuseppe erzählt mir etwas. Ich verstehe nur Italienisch. Auf der linken Seite liegt der Dorotheenstädtische Friedhof. Am Sonntag bei unserem Ausflug in die kleinteilige Bebauung des 18. und 19. Jahrhunderts hatte ich ihn rechts gesucht. Wir waren zwei Kilometer in beide Richtungen gegangen, bloß auf der verkehrten Straßenseite. Jetzt weiß ich es. Wir stehen länger im Stau, als wir vor Brechts und Schinkels Gräbern gestanden hätten. Ich traue mich nicht mehr, auf die Uhr zu sehen. Der Termin ist geplatzt. Dorothee wird kein Verständnis haben, auch wenn wir vor ihrem Friedhof festsitzen. Giuseppe erzählt. Ganz unnütz, dass ich mich so aufrege. „Nehmen Sie bitte Platz! Es wird noch ein Weilchen dauern“, wird die Sekretärin sagen.
Es geht weiter. U-Bahnhof Schwartzkopffstraße, das ehemalige ‚Walter-Ulbricht-Stadion‘ und gleich darauf das grüne Schild ‚Reinickendorf‘: wieder im Westen, aber ohne Erleichterung. 12.30 Uhr auf der Normal-Uhr. Rechts abbiegen, im Bogen fahren und dann wieder rechts abbiegen. Das war eine zu früh. Wir verlieren uns im Gewirr verkehrsberuhigter Einbahnstraßen. Mein Magen kocht. Konnte ich nicht früher aufstehen! Was hat mir das lange Liegen gebracht? Schweißausbrüche. Die winzig gedruckten Namen verschwimmen mir. Schwach tönt die Engelsstimme in mein Jammertal: „Nehmen Sie bitte Platz! Es wird noch ein Weilchen dauern.“ Wir fahren auf eine zweispurige Fahrbahn zu. Osloer Straße! Gerettet! Nach rechts. Da ist das Krankenhaus schon. Links rüber in die Drontheimer Straße. Der Eingang, wo ist der Eingang? Wir fahren schon an einer Brauerei vorbei. Giuseppe wendet unter Einsatz unseres Lebens. „Streichen Sie den Termin!“, sagt Herr Professor Büchsel, „und veranlassen Sie, dass Frau Dorothee Koehler nicht mehr von mir empfangen wird! Ich gehe jetzt zur Magenentnahme in den OP.“
Da ist der Eingang, schlicht wie eine Kittelschürze. Notfälle scheint es hier nicht zu geben. Ich springe aus dem Wagen und haste die fünf Stufen zur Schwingtür, „Professor Büchsel!“, schreie ich, als hätte ich einen Magendurchbruch.
„Erster Gang links, Zimmer 213“, sagt der Pförtner gelassen.
Ich stürze durch die Tür und keuche meinen Namen.
„Nehmen Sie bitte Platz! Es wird noch ein Weilchen dauern“, sagt die Sekretärin.
Ich laufe wieder auf die Straße. Giuseppes Wagen sehe ich auf der gegenüberliegenden Seite, ihn nicht. Ich renne die Straße auf und ab, zurück ins Krankenhaus, frage den Pförtner nicht: ‚Haben Sie so einen schönen, großen Italiener, der nach mir sucht, gesehen?‘, sondern suche selber weiter, gehe wieder auf die Straße, Giuseppe wird sich doch nicht verlaufen oder den Zug nach Verona genommen haben? Endlich entdecke ich ihn – in einer Telefonzelle. Er winkt mir zu. Ich nicke.
Er kommt mir entgegen. „La sorella“, sagt er.
Wir setzen uns in den Gang. Ich warte noch eine Dreiviertelstunde. Wenn ich pünktlich gewesen wäre, hätte ich eine ganze Stunde gewartet. Ich bin doch zu früh aufgestanden. Giuseppe wartet länger. Viel länger.
Professor Büchsel sei in meinem Alter, hat Dorothee gesagt. Das war nett von ihr, ich nehme an, er ist zehn Jahre jünger. Ich erzähle vollmundig von mir. Um meine Krankengeschichte verständlich zu machen, muss ich bei der schweren Geburt anfangen.
Herr Professor Büchsel findet das interessant und labt sich an meinen Formulierungen. „Endzeitstimmung“, er greift das Stichwort auf, „haben Sie ‚Großes Solo für Anton‘ gelesen? Das ist für mich die beste Schilderung einer Endzeitstimmung.“ Er schreibt mir Titel und Autor auf wie ein Rezept. Literarische Leiden gegen physische Leiden. Oder psychische? Doch nicht etwa eingebildete! Wir reden über eine Stunde. Er sagt einen Termin ab, dann beschäftigt er sich weiter mit mir. Als mein Leben auf neuestem Stand ist, geht er mit mir ein Stockwerk höher. Giuseppe liest. „Ist die Drei frei?“, fragt Herr Professor Büchsel.
„Nein, da ist gerade die Leberpunktur.“
„Warten Sie hier noch einen Augenblick!“
Alle sind eine halbe Stunde lang sehr freundlich zu mir, dann komme ich in die Drei und kriege einen Knebel mit Loch drin in den Mund, wie ich es sonst nur aus S&M-Heften kenne: Zwei-zwei-drei, zwei-zwei-drei. Ruf an!
Der Professor kommt. Ich bekomme eine Betäubung, die nicht wirkt, und etwas sehr Wirkungsvolles in den Mund gerammt. Vorher schon hatte man mir ein Spray in den Rachen gesprüht, das nach Magenbitter von Aldi schmeckte und mir den Schlund taub machte. Nun ging das Gerät die Kehle runter und entnahm Pröbchen.
‚Krebs‘, denke ich. Ich bin in Berlin. Mein an Aids krepierter Kollege Klaus Bülow fuhr auch noch mal nach Bad Gastein, seinen Geburtsort, bevor er starb.
Die Kostproben kommen mit dem Speise-Aufzug aus der Küche ins Esszimmer. Unten am Herd zwickt es etwas.
Der Professor wundert sich, dass ich wach geblieben bin. Es spricht für eine trainierte Leber. Was er auf dem Bildschirm gesehen hat, fand er nicht bedrohlich, aber behandlungsbedürftig. Den Rest an Klarheit werden die Proben ergeben.
Ergeben nehme ich das Rezept in Empfang und die Mahnung, weniger Alkohol zu trinken. Am kommenden Dienstag soll ich wieder anrufen. Den Befund wird er an mich und meinen Hamburger Hausarzt Roemmelt schicken. Es sei schön gewesen, mich kennengelernt zu haben.
‚In- und auswendig‘, denke ich.
Die Zeitung in Giuseppes Händen ist schon ganz lappig; sein BMW hat keinen Strafzettel. Das Besichtigungsprogramm kann weitergehen.
Who is who (Akkordeon)
1 – Volker Eckhoff
[ˈfɔlkɐ] [ˈɛkˌhɔf]
Volker Eckhoff leitete das Studio, in dem ich während meiner ‚Grammophon‘-Zeit die Promotion-Videos realisierte. Dreißig Jahre vorher waren wir schon zwei Jahre lang in dieselbe Schulklasse gegangen. Später hat er die sechsundvierzig Stunden all meiner Jahresfilme digitalisiert. Er trank und rauchte nicht, trieb Sport und starb vor vier Jahren an den Spätfolgen eines Schlaganfalls. Kein Vorbild.
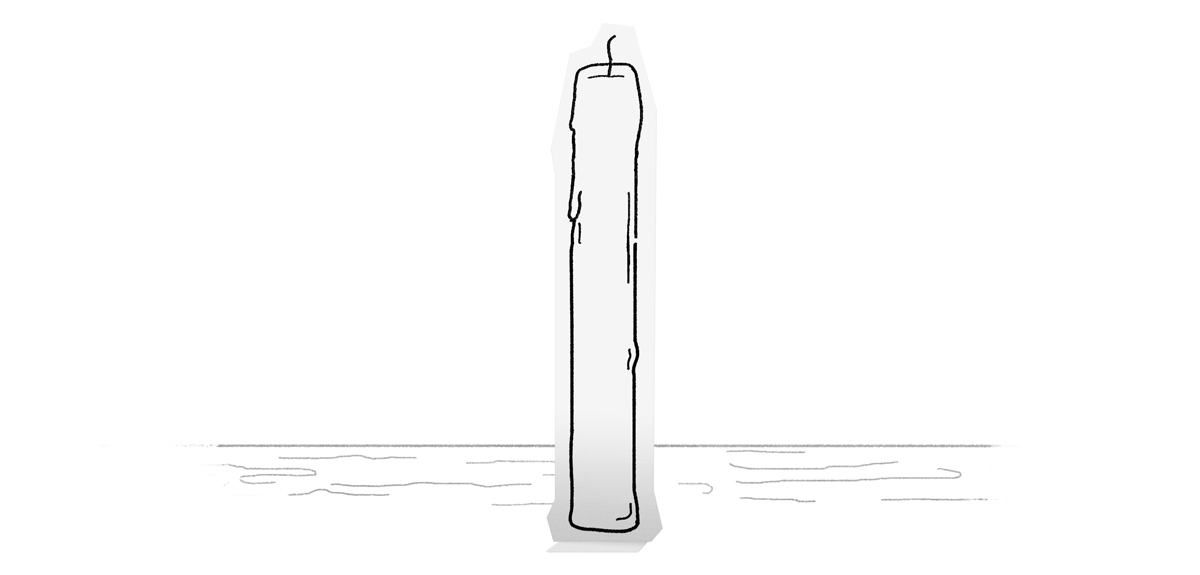
Titelgrafik mit Material von Shutterstock: Din Mohd Yaman (Wecker), BOYDTRIPHOTO (Ampeln), 134lnstudio (Bett), Yupa Watchanakit (Anker) und Fridolin freudenfett/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (Gebäude)

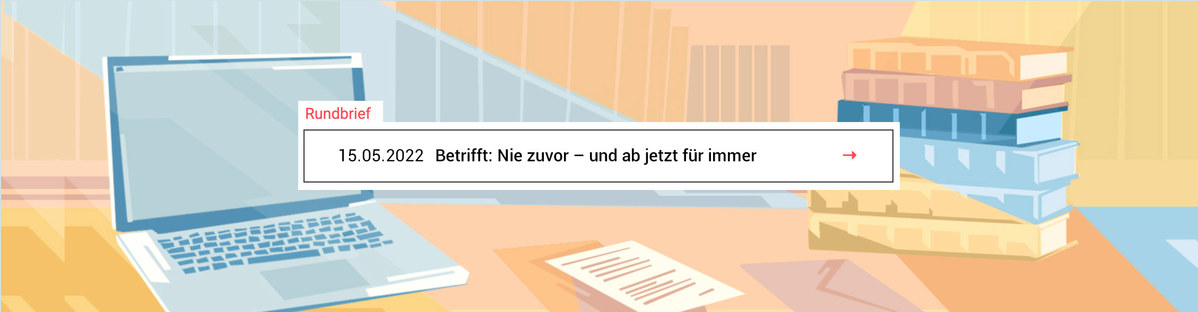







































































Aber warum dient Volker Eckhoff nicht als Vorbild? Weil er gestorben ist? Das tun wir irgendwann doch alle…
Nicht als Vorbild, auf Alkohol und Zigaretten zu verzichten.
Ich muss sagen, ich mag Emails mittlerweile auch viel lieber als Telefonanrufe. Gerade wenn es nicht um ein lockeres Gespräch mit Freunden geht, sondern um Geschäftliches und Verbindliches.
Mir dauert das oft zu lange. Ein Anruf erledigt ein Problem doch meistens viel schneller.
Aber bei e-mails kann man besser ausreden.
Vor allem kann man sich besser überlegen was man eigentlich sagen möchte. Und muss nicht von einer Sekunde auf die nächste eine schlaue Antwort parat haben.
Ja, da ist natürlich etwas dran, aber mich nervt diese Unverbindlichkeit auch manchmal. Wenn mal schnell eine Antwort braucht und das Gegenüber nicht reagiert, kann das sehr mühsam werden.
Zugegeben: meistens schreibe ich e-mails, wenn ich keine Lust zu reden habe. Aber wohlformulierte Sätze machen schriftlich auch mehr Eindruck als ins Handy gebrüllt.
Das schlimmste sind diese Sprachnachrichten, die man ins handy diktiert … und die man als Empfänger, dann für alle Umstehenden mithörbar abrufen muss.
Bloßstellung ist fast immer weniger angenehm als Intimität.
So sieht das zumindest aus, wenn man selbst betroffen ist. Am Schaden anderer erfreut man sich ja leichter. Leider.
Nicht bedrohlich, aber behandlungsbedürftig klingt immerhin nicht so schlimm, wie es hätte kommen können. Ich denke aber auch viel zu oft an Krebs oder andere lebensbedrohliche Sachen wenn es mir ‚grundlos‘ schlecht geht.
Grundlos gibt es eben nicht, weder beim Körper noch bei der Psyche.
In den meisten Fällen ist es zum Glück ja nicht gleich Krebs.
Wir haben zwei Neigungen: 1. die Gefahr zu verharmlosen und die Anzeichen zu leugnen 2. sofort den tödlichen Herzinfarkt zu vermuten, wenn es sich nur um eine verrutschte Blähung handelt. Zwischen diesen beiden Polen gestalten wir unser Leben.
Heute ist die Friedrichstraße verkehrsberuhigt und dementsprechend noch ausgestorbener. Egal an welchem Wochentag. Die Umweltschützer freut es, der Einzelhandel hingegen geht bankrott.
Wo ist denn da der Zusammenhang? Man fährt doch nicht mit dem Auto shoppen.
Und wenn, dann eher in die Outlets. Aber je leerer etwas ist, desto leerer bleibt es. Das sieht man auch in Straßencafés.
Ja das ist doch genau der Punkt. Wenn eine Gegend einmal unbelebt, unbefahren ist, dann leiden eben auch die lokalen Geschäfte. Bei der Berliner Friedrichstraße kenne ich das Konzept nicht genau, aber in meiner Erinnerung ist es keine besonders hübsche Straße um dort entlangzuspazieren.
Gucci, Prada und Louis Vuitton ist jedenfalls am oberen Ku’damm auf breiter Allee unter Platanen hübscher in die Schaufenster zu gucken als in der engen Friedrichstraße.
Oh! Dass ein Arzt sich einfach so ein Stunde Zeit nimmt, das ist mir aber auch noch nie passiert.
Da hat es ein kulturbeflissener Privatpatient bei einem kunstsinnigen Professor etwas leichter.
So scheint es. Toll in jedem Fall. Solche Kontakte muss man einfach haben. Oder mit etwas Glück machen.
Dorothees Vermittlung.
„Schön sie kennengelernt zu haben“ ist nach so einer Prozedur wirklich etwas seltsam 😂
Hahaha, na ja, aber was soll er denn sonst sagen!?
Floskeln sind in Ordnung. Vor allem am Anfang. Zu Geständnissen und Beleidigungen kann es später ja immer noch kommen.
Man muss ja auch erstmal ins Gespräch kommen. Die Fälle, in denen man jemandem begegnet und sofort im ersten Moment etwas wahnsinnig cleveres zu sagen hat, sind doch eher selten.
Glücksmomente der Intuition. Im Allgemeinen fallen einem die genau passenden Sätze erst nachts im Bett ein (also meistens ohne das angesprochene Gegenüber).
Literatur als Medizin ist ja keine schlechte Idee. Es hilft nur wohl am ehesten bei psychischen Problemen.
Sicher erfolgreicher bei Burn-out als bei Tumor.
Das ist natürlich überhaupt keine Frage. Es scheint aber ja trotzdem so zu sein, dass der Körper in jedem Falle besser heilt, wenn er Ruhe statt Stress bekommt. Möglicherweise kann eine entsprechende, also entspannende Lektüre dann sogar bei schlimmeren Krankheiten helfen. Als Ersatz für eine Therapie sollte man das natürlich nicht verstehen.
Nun ja, jeder muss auf sich aufpassen und dafür sorgen, dass es ihm seelisch gut geht. Aber wer ernsthaft erkrankt, der hört doch lieber auf den Arzt. Es gibt ja wirklich schon genug alternative Pseudotipps im Internet.
So ernst war das wohl auch nicht gemeint…