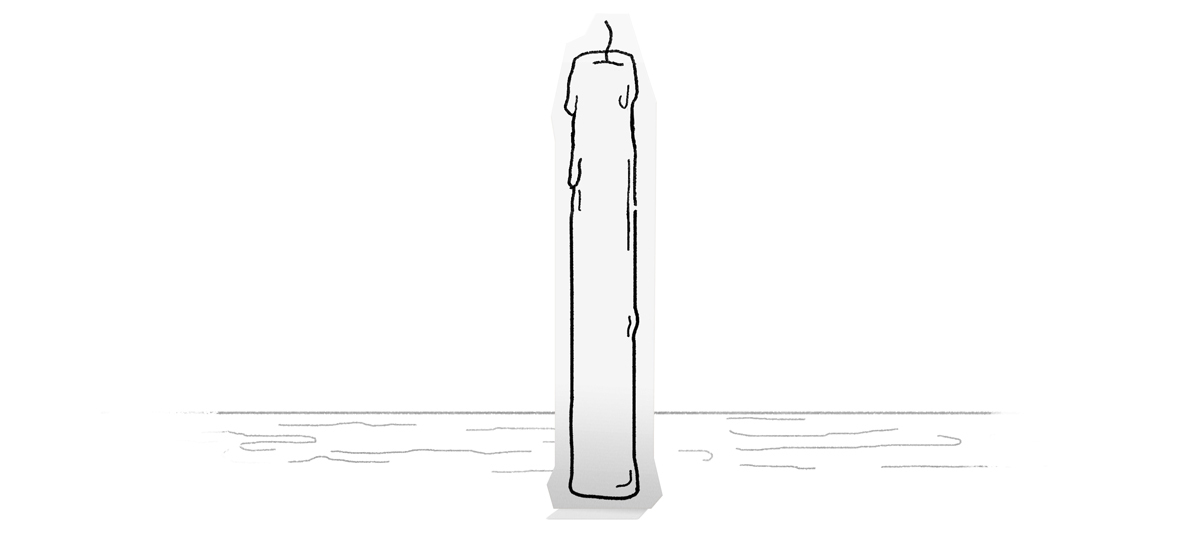

Dienstag, 4. Juli
Seit ewigen Zeiten schlief wieder jemand neben mir im Bett. Im Aufwachen dachte ich jedes Mal, es sei Roland. Mein linker Fuß, mein Ost-Fuß also, schmerzte bei jeder Bewegung. Mit herannahender Ausnüchterung im Morgengrauen kamen die üblichen Beschwerden hinzu; aber ich brauchte nicht mehr den Kopf zu heben, um zu sehen, ob Giuseppe schon aufgestanden war. Wie sich jeder denken kann, schlafe ich genauso oft ein wie ich aufwache, das ist bei allen so, nur nicht so häufig. Das allerletzte Mal Einschlafen, dem kein Aufwachen mehr folgt, beschäftigt mich zurzeit weniger denn je. Dafür wollte ich gerne wissen, was mit meinem Ost-Fuß los war. Ich verließ das Bett noch vorsichtiger als sonst. Mit beiden Füßen war das Laufen schwierig, aber nur mit dem linken Fuß hinkte ich, sah ich.
Ich führte Giuseppe im Wohnzimmer meine Gehweise vor und versuchte, das Beste aus der Situation zu machen: Ich legte mich schlafen. Mehr war mir nicht zuzumuten. Außer Dorothee. Sie weckte mich irgendwann gegen Mittag, unerbittlich wie immer. Seit wir uns am Donnerstag gesprochen hatten, hatte sie an drei Abenden für insgesamt elf Personen gekocht, einen zwischengeschobenen Termin beim Professor für Gastroenterologie im Neu-Westend-Krankenhaus für mich bekommen, zwei Ausstellungen gesehen, ein Konzert besucht, unser Erscheinen zum Abiturienten-Fest der Leonard-Bernstein-Schule bestätigt und, wie sie sagte, wegen Erschöpfung alles, was sie sich vorgenommen hatte, liegen lassen.
Ich sagte, ich könne am Abend nicht mitkommen zur Abiturfeier, mein Fuß sei geschwollen. „Da musst du dir so eine Bandage kaufen. In der Apotheke. Ich bin schon so oft umgeknickt. Mit Bandage geht das. Für Giuseppe ist das doch auch mal interessant, so eine Schule zu sehen. Ich hole euch ab, wir fahren bis Friedrichstraße, dann steigen wir noch mal am Alexanderplatz um in die U5 und fahren bis Louis-Lewin-Straße. Das sind achtzehn Stationen, aber man sitzt ja. Es dauert etwas über eine Stunde.“
Da ich am 6. Mai 1997 die Festansprache (zur Umbenennung der Schule) über Leonard Bernstein gehalten hatte, wusste ich nur zu gut, in welcher grottenhässlichen Plattenbau-Satelliten-Vorstadt diese Bildungsanstalt beheimatet war und dass es reizvoller für Giuseppe wäre, nachts um drei die unbehauste Gräfin-Voß-Straße zum abgeschafften Thälmann-Platz hinunterzuschlendern als über den Schulhof eines Gymnasiums in Marzahn-Hellersdorf zu laufen, diese totale Mega-Ätze, wo der Mantel der Berliner Geschichte nicht mal mit der Gürtelschnalle langgeschrammt ist, also wirklich! Echt bescheuert! – Das sagte ich aber nicht, sondern: „Ich glaube, ich kann nicht.“
„Ich bin bis fünf zu Hause“, Dorothee ließ nicht locker, „du kannst ja noch mal anrufen.“
Stattdessen wollte ich nichts als schlafen, aber dann humpelte ich doch, von Giuseppe begleitet, zur Apotheke. Der Apotheker schickte mich zur Röntgen-Ärztin, gleich um die Ecke. Sie war freundlich, in meinem Alter, nicht sehr besucht und tat mir höllisch weh, wobei sie sagte: „Jetzt tut es weh.“ Das merkte ich selber. Gebrochen sei nichts, befand sie, gerissen auch nicht, drei Monate dauern würde es trotzdem. Ihr mütterliches Wesen ließ erkennen, dass ’68 und die Studentenunruhen im anderen Teil Deutschlands an ihr vorübergegangen waren. „Das hätt’ man ja nie gedacht, dass man noch mal ’ne eigene Praxis haben würde …“, schwärmte sie. „Betreut wurde man in der DDR wahrscheinlich besser, aber die Medikamente habe ich doch gerne aus Basel gehabt und nicht aus Bitterfeld.“
Mit dem von Frau Doktor Wloszczynska fest angelegten Verband hinkte ich schon etwas sicherer zur Apotheke zurück. Der Pharmazeut war, was Alter und Mentalität anbetraf, vermutlich ein Kommilitone der Radiologin. Er verkaufte mir einen Elastikstrumpf und eine Salbe und war ausnehmend liebenswürdig, ohne zu ahnen, dass er nie wieder so wenig an mir verdienen würde.
Giuseppe ging ins Wohnzimmer, ich legte mich ins Bett, aber nun begann Dorothees Arznei zu wirken, nur flüchtiger Schlaf wollte aufkommen. Der Himmel war grau, die Gardine zu, das Ohropax im Ohr, aber dafür war ich doch nicht hier, und ich konnte ja Giuseppe auch nicht nebenan warten lassen, bis der Telefonsex im Fernsehen anfing, gestärkt für diesen Nervenkitzel mit nichts als Pflaumenmus.
Schließlich war ich weich genug geworden. „Man kann sich ja nicht so gehen lassen“, sagte ich, dachte aber: ‚doch, natürlich!‘ „Mit der U-Bahn kann ich aber nicht fahren“, erklärte ich Dorothee, „wir nehmen Giuseppes Auto.“
Sie ließ sich überreden: „Ich hol’ euch um halb sechs ab. Kommt runter, ich bin dann da.“ Dorothee war nicht da. Sie stand am Eingang Kronenstraße.
Das kommt davon, wenn man ein Haus beschläft, das drei Eingänge in drei verschiedenen Straßen hat. Wir trafen uns, wo kompromissbereite Menschen, die wir nicht sind, es tun: Auf der Mitte, in der Mitte – am Eingang Friedrichstraße: Jeder war ein Stück von seiner Warteposition gewichen, ich hinkend, Dorothee mit der leicht verschleppten Entschlossenheit, die ihr Gang ist. Kaum zu glauben, dass sie 82 ist. Umarmungen, Küsse. Dorothees Italienisch sprudelt selbstverständlicher als meins. Sie ist in Rom aufgewachsen und hat, nachdem sie von der ‚Deutschen Grammophon‘ weggegangen ist, zwei Semester in Perugia studiert – da kann ich mit meinem Bett-Wald-und-Wiesen-Italienisch natürlich kein Stadtfest ausrichten. Giuseppe verschwindet im Fahrstuhl und fährt in die Tiefgarage.
„Wo wart ihr gestern?“, fragt Dorothee, nicht aus Höflichkeit, sondern aus Neugierde.
Ich möchte es gerne kürzer machen: „Mittags waren wir in Glienicke …“ – „Habt ihr da gegessen? Das ist furchtbar teuer!“ – „… Und abends waren wir am Schildhorn.“ – „Ach, das ist so spießig.“
Ich habe weder da noch dort gegessen, tröste ich mich, und Giuseppe schien es geschmeckt zu haben. Da kommt er aus der Garage gebraust und bremst hart.
„Ich sitze lieber hinten“, sagt Dorothee wie immer.
Ich öffne ihr den Schlag. Als sie sitzt, schließe ich die Tür und nehme auf dem Beifahrer-, auch ‚Todessitz‘ genannt, Platz. Das Gebetbuch, den ‚Großraum-Stadtatlas‘, habe ich auf den Knien wie früher die Übersetzung bei den Latein-Klausuren. „Wir müssen ganz nach Osten“, lautet meine erste Angabe, „aber nicht so weit südlich wie Köpenick“, präzisiere ich. Giuseppe ist schon Droschkenkutscher genug, um damit etwas anfangen zu können.
„Hellersdorf, das ist Hellersdorf“, tönt Dorothee von hinten, ohne Giuseppe damit weiterzuhelfen. Am Spittelmarkt wird es etwas brenzlig. Mein Großraum-Stadtatlas ist gut im Detail, aber versteht das große Ganze nicht, das befindet sich zehn Seiten weiter und ist nur mit Mühe zurückzuverfolgen. Giuseppe fährt eine Straße weiter rechts ab als nach Köpenick. Wir fahren die berühmte Frankfurter Allee mit ihren stalinistischen Prachtbauten entlang, die wollte ich Giuseppe sowieso zeigen … – abgehakt.
„Wir müssen immer die U5 fahren“, sagt Dorothee, der Einbahnstraßen, aber auch Straßenzüge überhaupt, kein Begriff sind.
„Die Richtung stimmt“, sage ich wie der Bundespressesprecher.
„Wo sind wir denn hier?“, fragt Dorothee wie die Opposition.
Giuseppe hält.
Dorothee kurbelt das Fenster runter: „Hallo!“, schreit sie, dann wird es grün, Giuseppe braust los, und die Leute an der Bushaltestelle können sich so ihre Gedanken darüber machen, ob sie gerade eine Entführung miterlebt haben. „Die U5 nach Hönow“, sagt Dorothee.
„Alt-Biesdorf, das ist richtig“, sage ich.
„Wollt ihr nicht mal fragen?“, fragt Dorothee.
„Alt-Kaulsdorf, das ist auch richtig“, sage ich. Wer sich unter Alt-Biesdorf und Alt-Kaulsdorf Bauernhäuser vorstellt, wird beim Blick auf den Stadtplan eines Schlechteren belehrt. Platte an Platte, meterhoch, kilometerweit. Margot und der neue Mensch.
„Das ist ganz verkehrt!“, schreit Dorothee, sie vermisst die U-Bahn-Stationen.
„Hier rein in die Hönower Straße!“, sage ich.
„Hönower ist schon viel zu weit“, kreischt Dorothee, „wie Berg; also, wie Berg – der fragt auch nie! Mit der U-Bahn wären wir längst da. Wir kommen viel zu spät, und wir sind die Ehrengäste.“
Giuseppe fährt. ‚Berg‘ ist in Hamburg: ihr schwuler Modearzt. Welche Hete hielte das auch aus.
„Ist das da vorne die Risaer?“, frage ich mich laut. „Ja, links“, antworte ich auf Italienisch.
„Schrecklich“, seufzt Dorothee von hinten, ermattet.
Es ist doch eine Entführung, würden die Leute an der Bus-Haltestelle denken.
„Rechts!“, sage ich.
„Louis-Lewin-Straße, das ist richtig“, jubelt Dorothee, „fabelhaft! Ihr seid ja Asse!“
Giuseppe fährt.
Ich muss mich jetzt konzentrieren, denn statt dass die Neubausiedlung so klar strukturiert wäre wie ihre Gebäude, sind die Straßen ineinander verkrallt wie bei einer sozialistischen Orgie. „Jetzt links!“, rufe ich, es ist ein sportlicher Wettkampf gegen den Stadtplan.
„Adele-Sandrock-Straße“, Dorothee stößt es aus wie ‚Tor, Tor, Tor!‘.
Ich klappe das Übersetzungsbuch zu. „Hier, Leonard-Bernstein-Schule!“, darin liegt kein Feuer mehr, es ist nur noch Vollzug.
„Hier müssen wir parken!“, sagt Dorothee. Der Befehl einer U-Bahnfahrerin.
Auto an Auto; Kreuzung; wieder Auto an Auto. Gehweg. Platte. Schlimm. Wir halten einigermaßen vertretbar knapp vor einer Ecke. Ich versuche, nicht zu hinken, was wehtut und nicht gelingt.
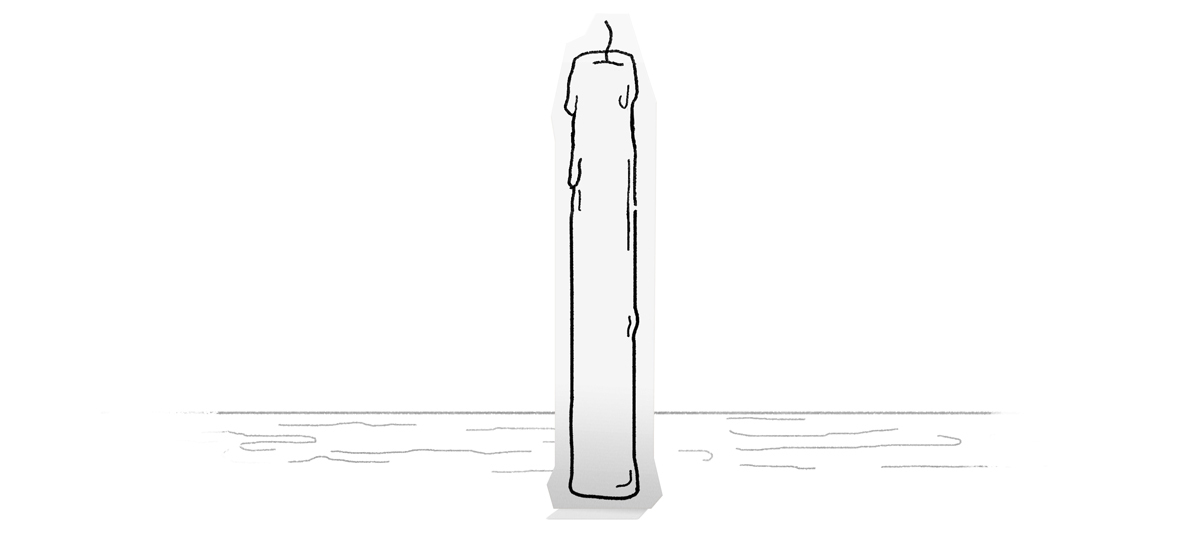
Titelgrafik mit Material von: O.PASH/Shutterstock (Fuß mit Bandage), Alexrk2/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (Berlin-Karte), Michael Kupsch/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (Marzahn-Panorama), Bundesarchiv, Bild 183-1987-0128-310, CC-BY-SA 3.0/Wikimedia Commons (Wohngebiet Marzahn, s/w), Johannes Nieke/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (Schulgebäude, Teilfassade, bearbeitet)
#2.15 | Irrwege ans Ziel#2.17 | Eine pädagogische Unterbrechung









































































Anstrengende Beifahrer sind ja wirklich anstrengend!
Aber Dorothee ist nochmal von einer Extra-Qualität (gewesen). Eifer und Unwissenheit sind eine beliebte Kombination. Ich vermisse sie.
Das glaube ich Ihnen nach den Beschreibungen aus den bisherigen Kapiteln sofort. Sie scheint wirklich besonders gewesen zu sein.
Drei Monate Knöchelschmerzen … das muss dann aber mindestens eine ordentliche Verstauchung gewesen sein.
So etwas zieht sich leider wirklich.
Spoiler: So lange hat es nicht gedauert. Nach ungefähr einer Woche war ich durch.
Mir hat ein Arzt mal gesagt je mehr man hinkt und den Fuß ’schont‘, desto länger dauert die Heilung. Man braucht wohl schon auch Bewegung um das ganze anzustoßen.
Hinken ist unvermeidlich, schonen nicht. Man schont sich nicht, sondern hinkt so lange, bis man es nicht mehr tut. (Mein orthopädisch inkompetenter Eindruck)
Haha, solche Stadtpläne, wo man immer 10 Seiten vor und zurück blättern muss um den Anschluss zu finden, die kenne ich auch noch zu gut. Ich war früher oft mit meinem Freund unterwegs und der konnte auf den Tod keine Pläne lesen.
Das Navi ist schon eine tolle Erleichterung, auch wenn es manchmal behauptet: ‚Strecke nicht erfasst.‘
Ich hab mich auch schon DANK Navi verfahren
Der sportliche Wettkampf geht halt genauso gegen den Stadtplan wie gegen die Navis. Haha!
Beim Navi kann man die Schuld abschieben und fluchen. Beim Stadtplan ist man selbst der Doofe.
Beim Stadtplan muss man dann höchstens über den Mitfahrer und Kartenleser fluchen.
Ein Abiturienten-Fest in einer Schule scheint mir das ermüdendste der ganzen Aufzählung zu sein…
Mein eigenes war eigentlich ganz ok.
Bei meiner Feier wurden wir aufgefordert: „Seid Sand im Getriebe!“ Das fand ich völlig unangemessen. Bei mir Zuhause ging es völlig unspießig, aber reibungslos zu. Die nächsten Jahrgänge haben dann so viel Sand ins Picknick getrampelt, dass manchem Lehrer der Appetit verging.
Hmmm, das klingt eher so als hätte jemand krampfhaft nach einem griffigen Satz gesucht. Heute klingt das ja sogar fast querdenkerisch.
So war das damals. Was glatt ging, war intellekuell verpönt.
Da spielt wahrscheinlich auch ein bisschen das Misstrauen allem was zu einfach ist mit hinein. Wo hingegen Widerstand überwunden werden muss, da vertraut man eher, dass das etwas vernünftiges ist.
Im übernächsten Beitrag werden Sie erfahren, wie ich die Abiturfeier erlebt habe.
Diese Orte sagen mir alle nichts. Habe ich da viel verpasst?
Der einheitliche Plattenbau für den neuen sozialistischen Menschen im Berliner Osten. Bei mir davon zu lesen, reicht.
Oh, na das klingt ja tatsächlich nicht sonderlich einladend.
Diese Gegenden gibt es in allen Großstädten der Welt. Touristen und Geschäftsleute sehen sie manchmal auf dem Weg vom Flugplatz zum Grand Hotel.
Meine einzige Geschäftsreise nach China fand ich in dieser Hinsicht ziemlich beeindruckend. Da fuhr man knapp eine Stunde nonstop durch solche Plattenwohngebiete bis man in etwas hübschere Ecken vordrang.
Sich vorzustellen, dass in all diesen Behausungen Menschen leben, ist gruselig. Und traurig.
Ich finde solche Wohnblöcke auch immer deprimierend. Da würde ich lieber in eine kleinere Stadt mit mehr Platz ziehen, wenn es die Arbeit erlaubt.
Gerade als Ehrengast darf man doch etwas zu spät kommen 😉 Das heizt die Erwartung der übrigen Gäste an.
Man muss nur aufpassen, dass die übrigen Gäste aus Langeweile nicht wieder nach Hause gehen bevor man überhaupt ankommt. Das macht den eigenen Auftritt dann ja wieder weniger imposant.
Diese Gefahr besteht bei Zwangsverpflichtung in der Schule nicht. Man sollte allerdings imstande sein, die gesteigerten Erwartungen des imposanten Spätauftritts durch eine brillante Darbietung zu erfüllen oder zu übertreffen.
Oh ja. Je höher die Erwartungshaltung, desto schwieriger ist es nämlich auch wieder, einen positiven Eindruck zu hinterlassen.
Dann kommt man als Darsteller eben rechtzeitig auf die Bühne, wenn die Spannung noch gering ist.
Erbarmungslos meint gegen sich selbst in dem Fall?
Nein, Dorothees Anspruch auf meine Teilnahme. Wo ich doch so gern im Bett bleiben wollte …
Gemein. Aber das Sie sich für Dorothee aus dem Bett quälen beweist ja wieder, warum diese Reihe als kleine Hommage an sie gedacht ist.
Was für ein Programm für eine 82jährige Frau. Also Respekt!
So hält man sich wohl jung. Viel tun, viel erleben.
Nicht jeder schafft das gesundheitlich. Aber wer in dem Alter noch so aktiv sein kann und will, der kann sich sicherlich glücklich schätzen.
Dorothee hatte damals zwei Krebs-Operationen hinter sich, den rechten Arm wegen Lymphknoten-Problemen ständig bandagiert und litt unter Angstzuständen. Frauen sind tapferer als Männer.
Ja diese Schlussfolgerung bezweifle ich mittlerweile auch nicht mehr…