Die Schule ist als Bau das Gegenteil von Bernstein: nüchtern, fantasielos, plump. Dorothee begrüßt den Direktor überschwänglich, er erkennt mich, findet aber den Gast aus Italien exotischer als einen Wessi. Der Musiklehrer begrüßt uns auch. Wir sind eine halbe Stunde zu früh und Giuseppe muss tatsächlich, ahnte ich’s doch, über den Schulhof. Ein Biotop wird auf Dorothees Drängen hin vorgeführt, wenn auch zögerlich. Selbst wenn das Verwilderte Sinn einer solchen Anlage sein sollte, so macht es sich ein Biologielehrer etwas einfach, wenn er das Nichtjäten von Unkraut zum Unterrichtspensum erklärt. Es findet eine vorweggenommene Art Austausch von Grußadressen statt, dann ist es endlich so weit, wir werden auf unsere Plätze in der ersten Reihe geleitet. Die bereits sitzenden Schüler starren uns an, und ich bringe eine gewisse Überlegenheit in mein Hinken. Der Direktor hält eine SED-Rede, in der ich als Funktionär lobend erwähnt werde und Dorothee als verdiente Pionierin des Volkes ausgezeichnet wird.
Dann beginnt die eigentliche Veranstaltung: für die lieben Eltern, die lieben Schüler und auch die lieben Gäste. Eine Nahtstelle – die Grenze zwischen Theorie und Praxis. Ab morgen, im wirklichen Leben, werden Können, Perfektion und Erfolg zählen. Hier, zum letzten Mal, reichen noch Begeisterung, Hingabe und Einsatz bis zur Opferbereitschaft aus, um Bestätigung und Anerkennung zu finden: von uns für euch – und für uns selbst.
Um die, die Talent haben, ist es mir am bangsten. Nur sie werden weitermachen und hoffen. Aufgeben, scheitern oder siegen. Ich denke an all die Studentengruppen, die ich in Israel, in London, in Amerika mit Bernsteins Werken erlebt habe. Mit ihm, für ihn, für sich. Ich war höchstens als Zaunkönig dabei; Mauerspecht, Feuervogel, der sich ein bisschen herauspickt aus der Glut, um selbst wieder leuchten zu können nach all der Asche des Tages und der Jahre. Kompliment und Herausforderung. Die Lebensgefährtin meiner früheren ‚Deutsche Grammophon‘-Kollegin und ‚Bild‘-Journalistin Dagni nennt mich deshalb ‚Phoenix‘.
Ich denke an meine Schulzeit, an alles, was ich nicht war: Schulsprecher, Sportskanone, Klassenbester. Ich war immer auffälliger Durchschnitt. Egonna Amalia Pumpernickel eben. Erst nach dem Abitur wurde ich zum Pfau. Ich fühle mein Herz schmerzen und schmelzen, der große Eisblock verpasster Gelegenheiten, verlorener Zeit und vergeudeter Talente taut auf beim Anblick dieser Gesichter, die erfüllt sind von dem Glauben, es schaffen zu können, voll sind von Erwartung und Entschlossenheit. Es sind die westlichen Ideale von der Durchsetzungskraft des Individuums, die in diesen Musical-Szenen immer mit Kraft und oft mit Geschick beschworen werden, nicht das Gruppengefühl der untergegangenen Arbeiterklasse, die hier im Dienstleistungsgewerbe des Showbusiness Zuflucht sucht und manchmal auch findet: Das Freche kommt nicht abgebrüht genug; in ‚That’s Life‘ liegt nicht genügend Achselzucken und in ‚I Will Survive‘ nicht genügend Bitterkeit – noch nicht, Gott sei Dank! Aber es ist alles schon da und ab morgen wird es schneller wachsen als unter der Aufsicht des Bio-Lehrers.
Die Abiturienten unter den Darstellern verabschieden sich öffentlich von den Mitwirkenden aus den Folgeklassen: Manche Freundschaft wird halten, mancher Traum wird sich erfüllen. Im nächsten Jahr wird es wieder so sein. Umarmungen. Tränen. Ich weine mit.
Wir Ehrengäste wurden anschließend zu einem Umtrunk ins Direktionszimmer gebeten. Es gab Rotkäppchen-Sekt, und Dorothee sagte: „Fand ich ganz fabelhaft. Fabelhaft.“ Wir stießen an auf eine scheidende Geschichtslehrerin, die auf einer anderen Schule ‚noch mal eine neue Herausforderung‘ annimmt. Sie hat die Darstellungsgruppe aufgebaut, ist dann aber übergangen worden.
Früher waren Lehrer für mich Respektspersonen gewesen, dann, als ich sie los war, versuchte ich, sie als Würstchen zu sehen – mein Beitrag zur 68er Aufmüpfigkeit. Lehrer sind Menschen – und verschieden wie Menschen. Natürlich ist Studienrätin Anette aus Othmarschen, ältere Schwester meiner Jugendfreundin Gisela, anders als die Pädagogin, die in Karl-Marx-Stadt unterrichtet worden ist. Die Ärztin von der FU (West) behandelt die Patienten etwas anders als die aus der Humboldt-Universität (Ost), aber das schleift sich an der Charité mehr und mehr ab. Wahrscheinlich bleibt die leicht unsicherere Zutraulichkeit des Ostens dabei eher auf der Strecke als die zielsichere Selbstbewusstheit des Westens. Deshalb wird man sich Erich Mielkes verklemmte Bombastik nicht zurückwünschen. Die Tugenden des Ostens sind alle aus der Not entstanden, nicht als Vorgabe der Ideologen. Amerika hat den ‚Hi, my name is Bob. I’m your host tonight‘-Kellner erschaffen; sein Ost-Pendant behauptete an der Tür eines leeren Speisesaals: „Geschlossene Gesellschaft, kein Eintritt.“
Gesiegt hat die offene Gesellschaft; nicht zuletzt deshalb, weil Trinkgeld-Abhängigkeit mehr Spraydosen-Charme versprühen muss als Lohn-Abhängigkeit in der (sowieso) herrschenden Arbeiterklasse. Gewiss, gesiegt hat auch die harte Währung, aber nicht – wie von der Ostpropaganda behauptet – durch Aggression, das hatte sie gar nicht nötig: Sie stand da, die Mauer wurde von der anderen Seite her gestürmt. Aber gesiegt hat auch ein Lebensgefühl, das unter der Gedächtnis-Kirche ärgerlicher, authentischer und identifizierbarer war als unter Honecker. Der freie Discjockey hatte gegenüber der Freien Deutschen Jugend die besseren Scheiben drauf. Ulbrichts 1965 vor dem ‚ZK der SED‘ geäußerter Wunsch „mit der Monotonie des Yeah, Yeah, Yeah und wie das alles heißt“ Schluss zu machen, ging bis zum Ende seiner kleinen DDR nicht in Erfüllung.
Retour legte Dorothee dieselbe Platte auf wie schon zuvor in der entgegengesetzten Richtung. „Das stimmt nicht!“ (Sie meinte die Richtung.) Giuseppe fuhr, ich blieb stumm.
„Hönow! Wir fahren verkehrt. Gleich sind wir raus aus Berlin. Wir fahren nach Osten.“
„Dorothee“, fing ich an, „das stimmt schon so.“
„Nein, wir fahren raus aus der Stadt.“
„Sag mir Bescheid, wenn wir in Warschau sind!“, kommentierte ich launig.
Dorothee schwieg.
„Ist das hier hässlich!“, sagte ich.
„Im Westen ist auch schrecklich gebaut worden.“
„Was ist denn das für ein Kasten! Forum-Hotel.“
„Das ist eine ganz große Kette. Ich habe in Essen in einem Forum-Hotel gewohnt. War ausgezeichnet.“
Wir hatten eine Anhöhe erreicht und fuhren die sechsspurige Ausfallstraße herab. Man sah nicht nur die Verwüstungen durch Architekten-Schreibtischtäter und Erfüllungsgehilfen-Maurer, sondern auch den Himmel, dessen Wolken nicht weniger klobig störten.
„Wir sind falsch, gleich sind wir draußen.“
Die matte Ergebenheit ihrer Stimme brachte mich auf. Wir kamen aus der Schule, ich durfte ein bisschen belehrend sein: „Siehst du den Himmel?“, fragte ich drohend. „Er ist rot da vorne. Wir fahren in den Sonnenuntergang. Siehst du, dass wir in den Sonnenuntergang fahren? Die Sonne geht im Westen unter. Also fahren wir richtig.“
„Ihr könnt mich am Bahnhof Friedrichstraße rauslassen.“
„Nein, Dorothee“, sagte Giuseppe auf Deutsch. „Wir bringen dich nach Hause.“
„Das ist nicht nötig.“
„Wollen wir nicht zusammen noch etwas essen?“, fragte ich. Das ‚nicht‘ war das ehrlichste Wort.
„Aber nichts Großes“, sagte Dorothee.
Nun beratschlagten sie und ich so eifrig miteinander, was wohl ein einfaches Lokal sei und wo man es finden könnte, dass ich es zum ersten Mal verpasste, den Übergang von Ost nach West zu bemerken.
„So eine richtige Berliner Kneipe!“, wünschte Dorothee sich. Eine falsche kannte ich in der Meinekestraße, aber die kannte Giuseppe auch schon. Ziemlich nahe an Dorothees Wohnung in der Bleibtreustraße fiel mir schließlich ‚Diener‘ ein, wo ich seit zwanzig Jahren nicht mehr gewesen bin. Weder Dorothee noch ich wussten, ob es nun in der Knesebeck- oder in der Grolmannstraße sei oder überhaupt noch existierte. In diesem beiderseitigen Zweifel fanden wir endlich doch zu unserer vertrauten Gemeinsamkeit; Giuseppe konnte sehen, wo er parkte. Ich weiß schon wieder nicht mehr, in welcher Straße es ist (wie in Hamburg die Geschäfte am Neuen Wall und in den Großen Bleichen nicht zu unterscheiden sind), aber natürlich war es in der anderen, was wir – klar – erst hinterher bemerkten; immerhin hatte ‚Diener‘ offen, vorwiegend für uns, und deutlich bodenständiger als in der Meinekestraße war es auch. Obwohl – die Wände waren zugenagelt mit Künstlerfotos, das neueste war eindeutig das von Peter Frankenfeld, zumal es noch mit seiner Widmung versehen war.
Dorothee riet mir – tief besorgt um meine Gesundheit – zu zwei original Königsberger Klopsen, weil doch Kalbfleisch so leicht sei. Es kamen zwei unentschärfte Bomben, wie man sie bisweilen in Berlin noch aufstöbert, in sämiger Tunke. Da sie in Giuseppes Magen nicht explodierten, waren sie vielleicht doch entschärft. Aber auch der irisierend schillernde Matjes konnte Giuseppe nicht töten. Manchmal denke ich, Giuseppes Magen ist ein Luftschutzbunker: Die Geschütze beirren ihn so wenig wie Psychopathen gutes Zureden. – Dorothee hat diesen entwaffnenden Trick, dass sie einen erst in eine Horrorspeise lockt und dann, angesichts des nicht zu bemäntelnden Desasters auf dem Teller, triumphiert: „Das koch’ ich dir mal!“ Es ist so, als ob ich sage: „Du musst den Sohn meiner Nachbarin Geige spielen hören!“ Und nach dem Ende des Gejaules sage ich: „So. Nächstes Mal lege ich dir Anne-Sophie Mutter in Dolby Surround auf!“
Am Nachbartisch tranken Leute Schnaps, das hätte ich auch gerne getan, aber ich mochte die Idee nicht, dass Dorothee mich verachten würde. Giuseppe hat mich noch ganz anders erlebt als blau. Aber Giuseppe ist Giuseppe, und Dorothee ist Dorothee. Und beide sind Freunde. Doch man ist Freunden gegenüber nicht immer gleich. Ich habe mich schon bloßgestellt und bloß gestellt. Lieber bin ich in Giuseppes Augen verletzlich als in Dorothees Augen schwach. Das Urteil anderer ist der Spiegel, vor dem ich mich schminke.
Wir brachten sie nach Hause. Es hatte aufgehört zu regnen, was es vorher getan hatte. Wir beugten uns über sie, um uns von ihr zu verabschieden und neu zu verabreden. Das matt beleuchtete Tor ihres Hauses; eine pulsierende, keine hektische Straße; Übereinkunft, die aus gemeinsamer Zeit entsteht. Buona notte, buona notte!
Giuseppe kannte den Weg, ich brauchte nichts zu sagen. „Molto eccezionale“, fasste Giuseppe Dorothee zusammen. Ich stimmte stumm zu. Beim Zähneputzen hörte ich aus dem Schlafzimmer: ‚Mein Mann ist verreist. Ich bin so geil. Ruf an!‘ Die Rufnummer hörte ich nicht, weil ich Wasser laufen ließ. Ich bin wohl der Mann, der verreist ist.

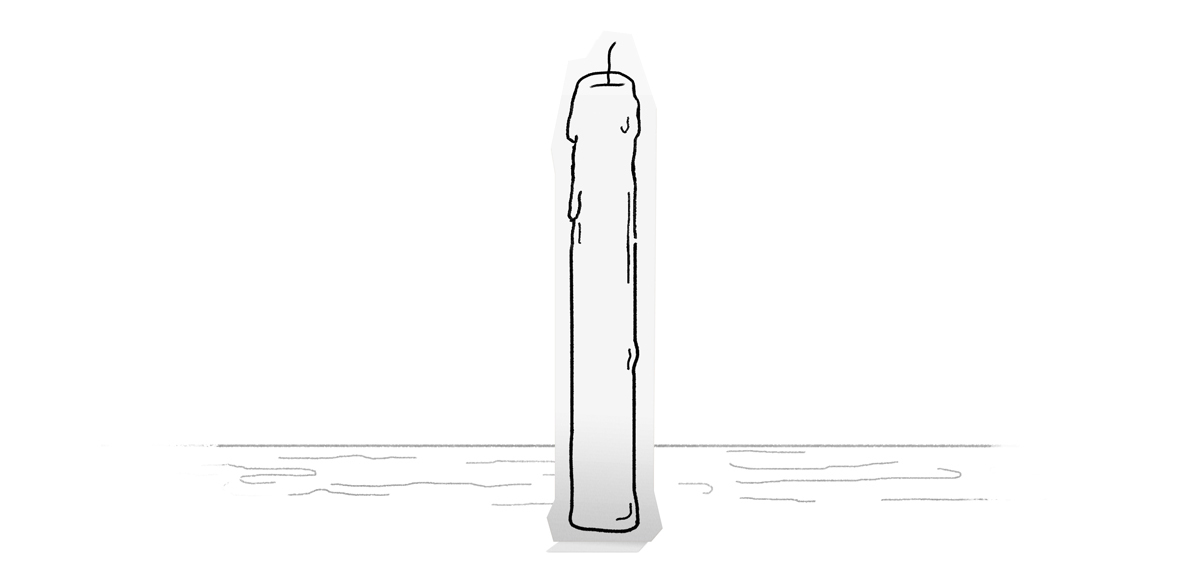
Titelgrafik mit Material von: Fridolin freudenfett/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (Savignyplatz), Lupus in Saxonia/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (Pioniergruß), photocrew1/Shutterstock (Klopse), createvil/Shutterstock (Telefonsex-Icon)
#2.17 | Eine pädagogische Unterbrechung#2.18 (B) | An etwas glauben









































































Mochte ich nie. Also die Königsberger.
Ähnlich geht es mir mit dem Rotkäppchen-Sekt
Zu DDR-Zeiten war er schlimmer.
Als Kind fand ich sie schrecklich. Jetzt geht es. Im dafür berühmten Berliner Lokal Marjellchen war ich schwer enttäuscht.
Das ist ja oft so, wenn es heißt in dem oder dem Lokal sei ein Gericht besonders gut. Da werden die Erwartungen dann selten erfüllt, finde ich.
Nun gibt es bei Königsberger Klopsen weniger Konkurrenz als bei Steak und Currywurst, aber die im Marjellchen schmeckten nach Kaliningrad.
Das klingt nicht besonders lecker. Bei meiner Mutter gingen sie sogar immer einigermaßen. Aber ein großer Fan bin ich trotzdem nie geworden.
Schulbauten sind ja gerne utilitaristisch. Wobei ein wenig mehr Phantasie oder Wärme den Schülern vielleicht mehr Spaß am Schulalltag geben würden.
Mag sein. Ich glaube aber nicht, dass hübsche Architektur alleine die Zukunft der Schüler und Studenten beeinflussen kann.
Allein nicht, zusätzlich aber doch.
Die Schüler sollen doch inspiriert und begeistert sein. Das liegt natürlich zuallererst mal an den Lehrern, aber es funktioniert trotzdem besser, wenn man nicht im Betonklotz oder Plattenbau lernen muss.
„Giuseppe ist Giuseppe, und Dorothee ist Dorothee“ sagt so viel über Freundschaften aus. In meinem Bekanntenkreis wird manchmal erwartet, dass alle die gleichen Interessen haben oder dieselben Veranstaltungen besuchen. Aber am Ende sind wir eben doch alle unterschiedlich und füllen dann eben auch unterschiedliche ‚Rollen‘ aus.
Na das ist doch klar. Man hat doch auch selten nur EINEN Freundeskreis.
Ich mag es trotzdem immer, wenn sich Freunde, die ich in unterschiedlichen Situationen gemacht habe, untereinander treffen.
Es ist nur tragisch, wenn die sich dann nicht verstehen.
‚Tragisch‘ nicht, aber traurig – und gar nicht selten.
Andersherum ist es so eine Freude, wenn die sich richtig mögen. Aber man muss so was ja auch nicht forcieren.
Meine Schul-Freundschaften sind mittlerweile alle verflogen. Das mag zum Teil auch daran liegen, dass ich nie eine besonders schöne Zeit in der Schule hatte. Da waren manche Freundschaften wohl doch eher Mittel zum Zweck.
Um die Zeit leichter durchzustehen? So etwas kann doch gerade zusammenschweißen.
Mein letzter Freund aus der Schulzeit starb 2004. 1990 versuchte noch einer ein Klassentreffen. Hat nicht geklappt.
Mein Abiturjahrgang versucht seit Jahren noch einmal ein Treffen zu organisieren. Bisher scheitert es immer kläglich.
Hat Dorothee ihre Versprechen bzgl. dem Selbstgekochten denn auch eingelöst? Oder war das eher nur eine Floskel?
War erst gemeint, blieb aber Floskel. Bis auf eine über mehrere Kapitel reichende Ausnahme ab #32.
Auffälliger Durchschnitt ist ja ein witziger Begriff. Vielleicht hätte das bei mir auch gepasst. Klassenbester oder Schulsprecher war ich bestimmt nicht. So viel Aufmerksamkeit hätte ich auch gar nicht gewollt. In der Menge untergegangen bin ich trotzdem nie.
Gegen Aufmerksamkeit hatte ich nichts, aber meine Möglichkeiten haben sich erst später entwickelt.
Oft kehrt sich das ja um. Die sogenannten Spätzünder überholen dann den Rest. Und die coolen Stufenlieblinge bleiben/enden überraschend doch gerne spießig in der Kleinstadt.
…sind aber möglicherweise genauso glücklich und zufrieden. wer weiss das schon.
Spießig in der Großstadt ist noch ärgerlicher. Aber vielleicht wäre man lieber ein glücklicher Spießer als ein unglücklicher intellektueller Bonvinant.
Ja wahrscheinlich. Wer sein eigenes Glück findet, den kümmert doch kaum, ob er von anderen möglicherweise als Spießer empfunden wird.
Hahaha, was wären Autofahrten nur ohne solche Richtungsdiskussionen!? 😆
Das kommt darauf an welches Verhältnis man zum Beifahrer hat. Mit manchen macht das irgendwie auch Spaß, mit anderen geht es sehr an die Nerven.
Das ist außerhalb des Autos ähnlich.
Begeisterung, Hingabe und Einsatz führen ja in der Regel auch zu Perfektion und Erfolg. Außer natürlich, das Können fehlt komplett. Dann wird es eher schwierig.
Dann kommt es zu Florence Foster Jenkins.
Hahaha! Oh Gott!