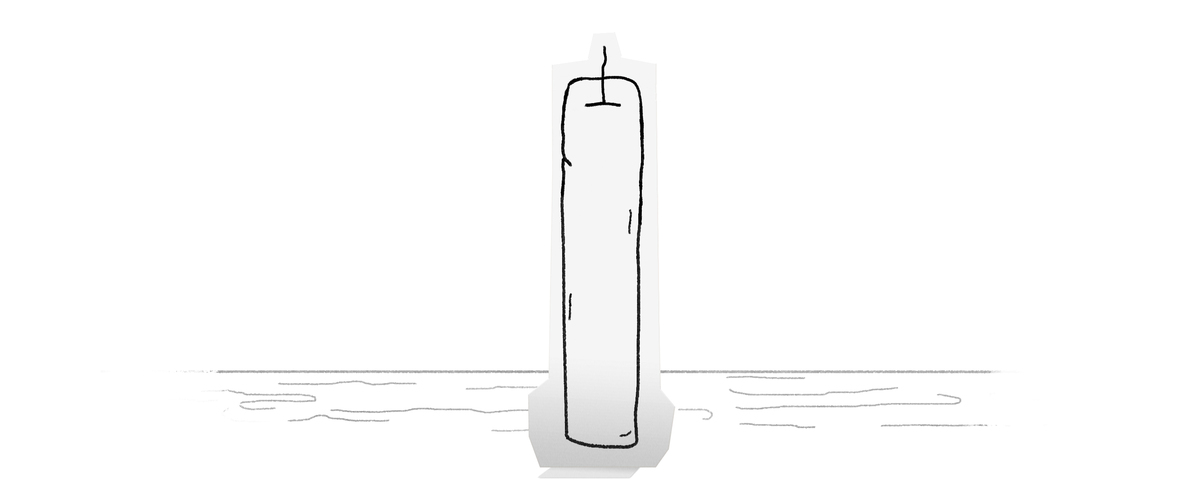

Giuseppe war etwas enttäuscht: Die sieben Hügel hatte er von Rom her anders in Erinnerung. Hier, in der Ausstellung ‚Sieben Hügel‘ im Gropius-Bau, waren sie ihm einfach zu flach. Ich fand den Bereich ‚Traum‘ am enttäuschendsten, weil ich von dem Thema etwas zu verstehen glaube. Alles andere betrachtete ich wie auf dem Jahrmarkt ‚die Dame ohne Unterleib‘ und die siamesischen Zwillinge im Einmachglas. Aber Traum? Das Wesen des Traumes ist es, dass wir mit ihm auf so seltsame Weise allein sind wie im wachen Zustand nur selten – denn wir teilen unsere Erlebnisse im Traum oft mit Menschen, die es nur gibt, weil wir sie träumen. Daneben begegnen uns natürlich auch all die Lebenden und die Toten, an die wir tagsüber denken oder die wir vergessen haben.
Die Vertrauten und die Fremden verlassen uns im Aufwachen und waren nie da. Was habe ich mich mit diesem Problem schon herumgeschlagen: Ich habe gesagt: „Wozu soll ich weiter mit dir reden, ich träume dich ja nur.“ Und er hat mir geantwortet: „Und was hast du davon, stumm zu bleiben? Jetzt bin ich bei dir. Also rede mit mir! Was später kommt, zählt nicht!“ Oder ich habe gesagt: „Es ist so schade, dass ich das allein erlebe, ohne dich.“ Und er hat mich beruhigt: „Aber nein, ich träume zurzeit genau dasselbe wie du. Wenn wir wach sind, können wir uns darüber unterhalten.“
Traum ist Trug und Wahrheit zugleich, und manchmal kommt mir der Verdacht, ich trinke so viel, um für alles, was Wirklichkeit ist, zu müde zu werden. In der Ausstellung: kein Joseph und seine Brüder, kein märchenhaftes Fliegen – Krimskrams neben kostbaren Objekten. Aber immerhin: Drei Stunden Budenzauber, dann kehrten wir ans Tageslicht zurück und peilten zielstrebig den Potsdamer Platz an.
Wenn ich meinem Berlin-Aufenthalt erwartungsfroh entgegengesehen hatte, dann bündelte sich diese freudige Neugier im Erlebnis des Potsdamer Platzes: ‚Da, wo einstmals …‘ – und jetzt wieder? Wenn ich das Ereignis des Potsdamer Platzes mit einer Theateraufführung gleichsetze, so betraten wir die Einheit von Zuschauerraum und Bühne, nicht von einem festlichen Foyer mit Sektausschank aus, sondern kletterten über Kabel und Statisten. Der P. P. liegt als Insel in einem Meer von Bauschutt. So stellt sich bereits vor Erreichen des Ziels ein Hauch von Voreingenommenheit ein: Bei mir jedenfalls; ich will doch immer alles ganz perfekt haben – Disneyland ist für mich die passendste Kulisse. Das Werden, das Making-of … geht mich nicht ans. Am fertigen Objekt will ich Sprache, Architektur oder musikalischen Fluss analysieren. Himmel und Hölle sollen mir die Darsteller spielen. Die Bühne muss realistisch hergerichtet sein, damit mich keine störende Abstraktion vom Geschehen als der einzig nachvollziehbaren Wirklichkeit ablenkt.
Wir landeten in einer Ladenpassage, wie sie heutzutage von Wilmersdorf bis Warschau so vorkommen. Den kosmetischen Standard setzte die Parfümerie Douglas, den kulinarischen der Burger King. Es war dramaturgisch vernünftig, dass wir auf das Nichtssagende zuerst stießen. Trat man seitlich aus der Kaufgasse ins Freie, befand man sich auf einem Platz. Da stand das Haus Huth, eingezwängt in Neues. Von seinem Dach aus hatte ich 1984 für den Karajan-Symphonien-Film die Kamera schwenken lassen: Öde ringsum, westlich begrenzt durch die Philharmonie, östlich durch die Mauer. Die Ergriffenheit, dieses frisch geputzte Haus nun inmitten von großstädtischem Leben zu sehen, wurde ihrer Weihe beraubt durch die Aufschrift ‚Tchibo im Haus Huth. Selbstbedienung‘.
Ging man über die breite, unbefahrene Straße, so gelangte man vom sogenannten Mercedes- zum sogenannten Sony-Teil, da war man unter einer Art Zelt, denn der ummauerte Rundplatz hatte hoch oben eine Art schiefes, spitzes Hütchen aufgesetzt bekommen, das aber zu klein war und deshalb mit Stahlseilen an den runden Wänden hatte festgezurrt werden müssen. Mitten auf dem Platz der unvermeidliche Brunnen, der sich mit allen Wassern aufplusterte, die Spree und Wasserwerke ihm zur Verfügung stellten.
Die Anlage wurde von den Berlinern, wie Marketingstrategen sagen würden, ‚gut angenommen‘. Mitten am helllichten, wenn auch stark umwölkten Tage saßen Unmengen von Menschen bei Tchibo und bei Eduscho auf den Bistro-Stühlen des (irritierend benannten) ‚Alex‘ sowie vor den Pizzerien, auf Brunnenrand und Treppenstufe. – Da hatte ich nun meine konkrete, realistische Welt, voll von Darstellern, ohne dass sich das rechte Glücksgefühl einstellen mochte: Ein hochgelobtes Buch, ein sehnsüchtig erwarteter Ort – die Wirklichkeit besteht dann doch aus Buchstaben und Steinen, nur selten verschwimmen die Zutaten zu jenem Zauber, der uns in seligem Schmecken das Rezept gänzlich vergessen lässt.
„Vielleicht könnte man eine Kleinigkeit essen“, mahnte Bo. Und für solche Vergessenheit bietet eine Palladio-Villa – einsam zwischen venetische Hügel gebettet – doch bessere Voraussetzungen als bunt gekleidete Menschen, die vor buntem Kuchen sitzen, den sie sich am ‚Tortenbüfett‘ selber aufgetellert haben und sich nicht dazu verpflichtet fühlen, mir einen geistigen Raum auszufüllen, dessen Körperlichkeit wenig hergibt.
Ich hatte irgendwo eine Sushibar entdeckt und das Gefühl, etwas anderes könnte ich auch nicht schlucken. Schweden und Italiener sind ja Meeresvölker; die müssen das auch zwei Male hintereinander mögen. Das Lokal war klein wie alle Sushibars, aber origineller als alle, die ich bisher gesehen hatte: Man saß auf Barhockern wie in der Halbleiterherstellung bei Siemens zu meiner Lehrlingszeit. Auf dem Fließband lagen in Plastiknäpfchen einzelne Sushis, Babys in der Wiege, auch Zwillinge aus Lachs oder rotem Kaviar. Wie bei der Gepäckausgabe am Flughafen lief das Laufband in einem Oval: Stücke, die beim ersten Durchgang noch keinen Liebhaber gefunden hatten, durften sich doch Hoffnungen machen, als Happen zweiter oder dritter Wahl einen Käufer zu finden. In einer Mischung aus Mitleid und Gier schnappt man sich mehr als eigentlich notwendig; nach dem dritten Sake sinkt auch die Hemmschwelle ein wenig.
Ich glaube, Ingrid mag keinen Fisch, ich hatte Bo gestern so verstanden und fragte sie sicherheitshalber, ob alles in Ordnung sei. „Yes“, sagte sie. Ich war beruhigt und nahm noch ein Thunfisch-Sashimi, das mithilfe von Sojasoße und Wasabi den charakteristischen Geschmack von Wasabi und Sojasoße annahm. Sieht man die Einrichtung nicht nur vom gastronomischen, sondern auch vom ökonomischen Standpunkt aus, so ergibt sie viel Sinn: Im Handumdrehen hat man genauso viel Geld ausgegeben wie nach vier Gängen in einem Restaurant traditioneller Machart.
Bo war ganz versessen darauf, das 3D-Kino zu besuchen. Wir bekamen also alle vier eine Eintrittskarte, die Weisung, mit der schier endlosen Rolltreppe unters Dach zu fahren, und dort eine etwas eklige Plastikbrille in die Hand gedrückt. Es gab eine Bar, eine Toilette und einen Empfang; ich machte von allen dreien in eben dieser Reihenfolge Gebrauch und stand im Dunkeln. Vor mir türmten sich die steil aufragenden Reihen eines flach gewölbten Amphitheater-Halbrunds auf, seitlich spendete eine riesige Leinwand, an deren unterem Ende ich stockte, wenig Licht. Wir stolperten die Stufen aufwärts. Die Augen begannen, Sitze und Menschen wahrzunehmen. Ich schob mich an Knien vorbei in eine Reihe, die anderen drei folgten mir auffällig. Wir setzten uns, was immer, wenn man nicht sieht, wohin, mit einem gewissen Unbehagen geschieht: Man hofft auf Polster und fürchtet Nesseln.
Der Film lief schon. Er war deutlich jugendfrei und handelte von einem kleinen Jungen, der allein nach New York kommt. Ohne die Brille sah man alles nur verschwommen, mit Brille war es plastisch. Fantastisch! Raffiniert pendelte der haardünne Handlungsfaden zwischen historischen (aber ebenfalls dreidimensional aufbereiteten) Szenen und dem Jetzt hin und her. Mal handelte es sich um den ausgewanderten Urgroßvater des kleinen Jungen, mal um den Ausreißer und Nachkömmling selbst. Die Leinwand reichte so weit, wie man sehen konnte, und alles kam auf einen zu, schien zum Greifen nah. Ein weniger jugendfreier Film würde allabendlich sämtliche Kassenrekorde sprengen. Jeder Zuschauer müsste sich allerdings über das, was ihn sexuell stimuliert, genauso viel wissen wie über das, was der Regisseur für stimulierend hält, sonst ist so ein Zoom in die Häuserschluchten New Yorks doch empfehlenswerter.
Da nach diesem sinneverwirrenden Erlebnis auch Ingrid, Bo und Giuseppe die Stufen heruntertorkelten, nahm ich an, dass mein Alkoholkonsum noch kein ver-tret-bares Maß überschritten hatte.
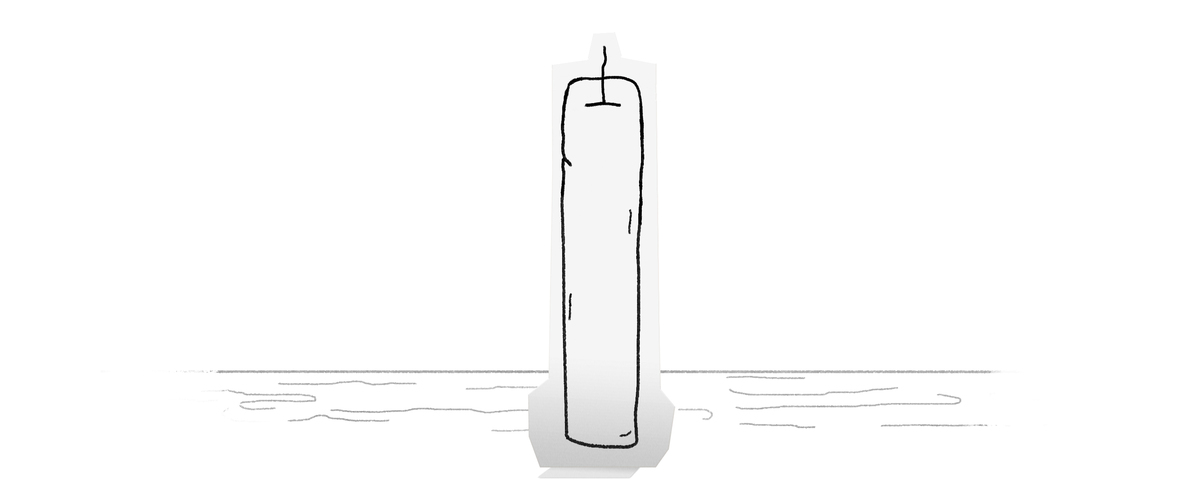
Titelgrafik mit Material von: Tuxyso/Wikimedia Commons, CC BY-SA-3.0 (Hochhäuser Potsdamer Platz), Andreas Steinhoff/Wikimedia Commons (Haus Huth) und von Shutterstock: No-Te Eksarunchai (Kofferband), Rido (Sushi), Bulut Cebe (3D-Brille)

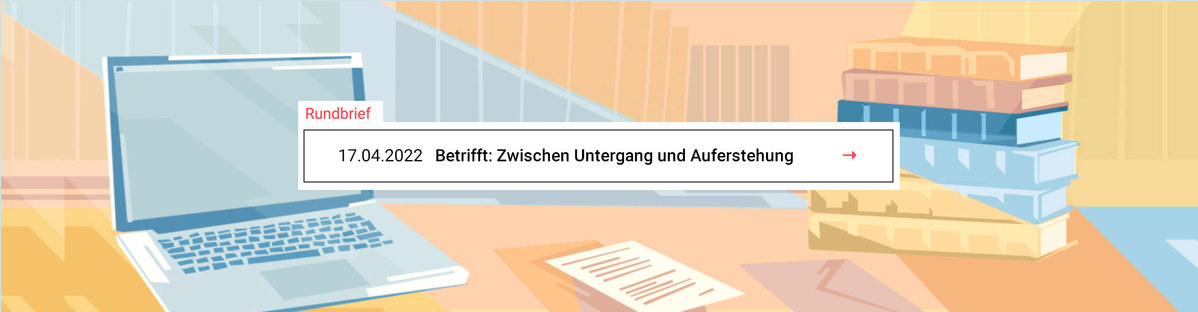







































































3D Kino ist immer noch so ein riesiger Publikumsmagnet. Dabei sind die Filme meistens fürchterlich.
Naja, es ist zum großen Teil eben doch immer Effekthascherei.
Ich habe das Gefühl, dass dieser erste Trend langsam wieder vorbei ist. Mittlerweile benutzt man 3D-Technik doch hauptsächlich für ein paar ausgesuchte Blockbuster, wo man denkt, dass sie dadurch noch ein paar € extra einspielen. Aus künstlerischer Sicht scheint das kaum einen Regisseur zu interessieren.
Je eindimensionaler das Denken der Protagonist(inn)en, desto wichtiger das plastische Bild von Gegend als Bei-der-Stange-halter. So ist Kino, späterstens seit James Bond.
Nur geht es mir meistens so, dass ich wegen der albernen Effekte nich weniger an der Story interessiert bin, als es vielleicht eh schon der Fall wäre.
Ausnahmen geben der Regel erst ihre Bestätigung. Die Idee: Je mehr vernünftige Menschen abschalten, desto mehr dämliche kann man kapern.
hahaha
Wobei dieser erwähnte Film ja äußerst ungewöhnlich für einen 3D Film scheint.
Allgemeinbildend und jugendfrei.
So ein „Running Sushi“ Erlebnis hatte ich in Kyoto einmal. Das Ambiente muss ja auch irgendwie stimmen.
Man kann deswegen aber nicht jedes Mal nach Japan reisen 🙄
Muss man auch nicht. Wie öde das ist, kann man inzwischen auch in Deutschland viererorts erleben.
Sushi soll ja nicht unbedingt aufregend sein, sondern lecker. Da hat man in Japan allerdings immer noch deutlich bessere Chance als in Deutschland.
…und bei Sashimi bessere Chancen als bei Sushi.
Hahahaha, dieses „Vielleicht könnte man eine Kleinigkeit essen“ wird zum running gag.
Ich wusste nie: Hat er wirklich Hunger oder will er bloß nicht weiter laufen. Beides legitim.
Städtereisen sind ja auch anstrengend 😉
Der Potsdamer Platz ist heute noch schlimmer geworden als er bei seiner Fertigstellung schon war. Recht erstaunlich.
Es gibt dort halt einfach weder besonders viel zu sehen noch viel zu tun. Als Touristenhotspot reicht das vielleicht, aber lange dort zu verweilen lohnt sich nicht wirklich.
Der Postdamer Platz ist wenig besser als der Alexanderplatz, aber in London bin ich auf dem Piccadilly-Circus auch nicht länger. als es dauert, ihn zu überqueren.
Das stimmt sicher. Piccadilly Circus, Times Square, Potsdamer Platz – die sind alle nicht dazu da, dort gemütlich in der Sonne zu sitzen.
Dass man da zwischen Sony- und Mercedes-Teil unterscheidet, wusste ich gar nicht.
Ein bisschen Disneyland ist der Potsdamer Platz ja sogar. Da wird dem Touristen vorgegaukelt, dass Berlin Weltstadt ist. Nur, dass man bei näheren Hinsehen merkt, dass das alles nur künstlich fabriziert ist. Dass hier gar kein Berliner herkommt oder zumindest nicht lange hier verweilt.
Der Potsdamer Platz war vom Krieg und von der Mauer ausradiert. Wenn er plötzlich wiedererstehen soll, ist Künstlichkeit unvermeidlich. Etwas inspirierter hätte das Ergebnis allerdings ausfallen dürfen.
Über die Architektur kann man ja denken, was man will. Da gehen die Geschmäcker sicherlich auseinander. Mir hat dort ein wenig mehr Leben gefehlt. Oder zumindest ein paar mehr Angebote jenseits der typischen Touristen-Spots.
Zum Thema Träume (und Trauma) gab es in der Wiener Kunsthalle mal eine tolle Ausstellung. Das muss aber mittlerweile auch schon fast zehn Jahre her sein.
Dann wird es ja Zeit für einen Neuanfang. Anlass für traumatische Träume bietet die Realität weißgott genug.
„Daneben begegnen uns natürlich auch all die Lebenden und die Toten, an die wir tagsüber denken oder die wir vergessen haben.“ – gerade zum Osterfest gehe ich gerne zum Grab meiner Eltern und erinnere mich an alles, was wir gemeinsam erlebt haben.
Das Grab brauche ich nicht. Das Bett reicht mir. Da vergegenwärtige ich mir im Dunkeln die Lebenden. Am Grab stört mich ihr Totsein.
Ich mochte Friedhöfe sowieso nie. Ich trauere um meine Lieben lieber an den Orten, an denen wir schöne Erinnerungen zusammen erlebt haben.
„Was später kommt, zählt nicht“ ist ein wirklich schönes Motto.
… und der, der es im Traum zu einem sagt, ist man wohl selbst.
Dass sich diese Douglas/Burger King – Passagen überhaupt noch halten können, ist mir wirklich ein Rätsel.
Ein Rätsel, das sich zurzeit zu lösen scheint.
Ich sehe auch immer mehr leer stehende Malls. Das Prinzip scheint sich tatsächlich etwas erschöpft zu haben.
Vor allem wurde während der Pandemie noch mehr online gekauft als vorher schon. Den kleinen Geschäften geht es da momentan ja nicht viel besser als den riesigen Einkaufszentren. Ist etwas einmal angewöhnt, lässt es sich schwer wieder rückgängig machen.
Das Kauferlebnis ist unterwegs befriedigender. Online ist bequemer. Erlebnisse gibt es für die meisten auch so genug.
_Die Bühne muss realistisch hergerichtet sein, damit mich keine störende Abstraktion vom Geschehen als der einzig nachvollziehbaren Wirklichkeit ablenkt.
Diese Diskussion finde ich immer wieder interessant. Ich finde ja nach wie vor, dass ein wenig Abstraktion den Text und damit auch das Geschehen viel mehr hervorholt, als es ein paar historisch korrekte Rüschen am Kostüm oder die verzierten Türbögen an der Residenz der Darsteller können. Aber das nimmt jeder anders auf und darum kann man wohl auch nichts gegen die unterschiedlichen Inszenierungen sagen. Außer natürlich ob man sie persönlich mag oder nicht.
Theater darf und muss abstrahieren, spätestens seit es Kino gibt. Im Film finde ich Abstraktionen oft gewollt ‚arthouse’ig.
Das habe ich neulich beim Hamlet der Coen-Brüder gedacht. Das war doch alles arg anstrengend.
Die expressionistischen deutschen Filme der 1920er Jahre gelten als wegweisend. Ich finde, sie führten in eine Sackgasse. Die Handlung und die Darsteller von ‚Metropolis‘ finde ich unerträglich – egal, wie bildmächtig das Konzept sein mag.