Beitrag zur Grußwortsammlung anlässlich des
Abschieds von Dorothee Koehler
Als ich Dorothee 1972 wiedertraf, sagte sie statt ‚Guten Tag‘: „Wir kennen uns noch nicht!“ Zu den anderen sagte sie gar nichts, aber viel neugieriger schien sie auf mich auch nicht zu sein. Sie ließ ihre prall gefüllten Tüten aus den Händen fallen und sich selbst auf den Stuhl dazwischen.
„Doch“, sagte ich, „ich war mal vor zwei Jahren als Lehrling bei Ihnen.“
„Ach so“, antwortete sie, „dann kennen wir uns eben doch.“
Offenbar wollte sie möglichst schnell zur Sache kommen. Alles Entscheidende – genauer: alle Entscheidenden – waren dem Firmengeflüster zufolge immer schon unglaublich wichtig für sie gewesen, aber eigentlich doch bloß nebensächlich gegenüber dem, worum es wirklich ging – nur: Was war das? Es mochte in ihren Plastiktüten zu finden sein – das ganze vollgedruckte Papier, das sie ständig mit sich schleppte, Bürden, Trophäen: Englische, französische, italienische Zeitungen, Budgetplanungen, Fachzeitschriften, Bitt- und Dankesbriefe; und alles, alles, was auf den zerknitterten Papieren zum Lesen in Bereitschaft stand, war jeweils eine Aussage über irgendetwas. Eine Botschaft vielleicht?
Richtig war, dass meine erste Begegnung mit Dorothee nicht allzu glücklich verlaufen war und ich Grund hatte, eher erleichtert als gekränkt zu sein, dass sie sich an mich nicht erinnern konnte. Damals war ich frisch von der Musikhochschule gekommen, und sie war nach langjähriger Vertriebstätigkeit die erste PR-Chefin des Hauses ‚Deutsche Grammophon‘ geworden. Solche Positionen brauchen zu müssen, fing man damals an zu glauben; aber von unterschiedlicheren Dingen als Dorothee und mir konnte man wohl gar nicht reden, wenn man das Wort ‚Musik‘ in den Mund nahm. Auszubildende wurden sonst nie bis zu ihr vorgelassen, zu aller Nutzen; für solche Informationsverrichtungen hatte sie Frau Steck. Aber ich bestand darauf; ihre Sekretärin richtete es zwischen zwei Terminen ein, und so lernte ich Dorothee kennen: sie – hochfahrend, abgelenkt, enthusiastisch; ich – verschreckt, anmaßend, auf Eindruck bedacht, und sei er noch so schlecht. Offensichtlich in diesem Fall erfolglos, denn jetzt, zwei Jahre später, war ich für sie wieder ein unbeschriebenes Blatt, und selbst ihr Parfüm roch anders.
Wir setzten uns um sie herum: direkt neben sie mein Chef, ihr wirklich nicht beneidenswerter Nach-Nachfolger auf dem Stuhl für das, was man im ‚Stammhaus‘ sinnesfeindlich ‚Repertoire-Auswertung E-Musik‘ nannte; ihm gegenüber der für die Fabrikkontakte zuständige Sachbearbeiter – und dann noch ich. Ich hatte mich inzwischen zum Product Manager für Neuaufnahmen emporgearbeitet. Das war – im Gegensatz zur weniger angesehenen ‚Zweit-Auswertung‘, zu der jemand auch Begabung fürs Titeln und Fantasie fürs Koppeln hätte mitbringen dürfen – ein Posten, auf dem man dafür zu sorgen hatte, dass zunächst die (Musik-)Welt die Suppe auslöffelte, die ‚die Produktion‘ angerichtet hatte, um später die leergegessenen Platten-Teller von den Katalog-Tafeln abzuräumen, rechtzeitig für die nächsten Varianten desselben Gerichts und flink genug, bevor man Ärger mit der Lagerhaltung bekam. Aber auch da konnte ‚die Produktion‘ einem noch in die schale Suppe spucken und darauf bestehen, Aufnahme-Schätze eines durch einen vielversprechenden Interpreten eingespielten Werkes eines verkannten Komponisten in den Regalen weiter einstauben zu lassen – wegen unwiderlegbarer Unwiederbringlichkeit.
So ließ sich die demütige ‚Repertoire-Auswertung‘, die noch nicht die Macht eines heutigen Marketings besaß, zwingen, Jahr um Jahr wohlbeleumundete alte Jungfern im Zentrallager als heiratsfähig herumlungern zu lassen, obwohl selbst Liebhaber ausgefallenster Spezialitäten zwischen Sydney und Stockholm keine Neigung zeigten, die Ware abzurufen. Den Landesvertretern war das schnuppe: Die bestellten einfach nicht.
Nur mit dem deutschen, dem ‚Home Market‘ gab es einen Höflichkeitsaustausch: Streichungsmeeting. Zu viert am schwarzen Tisch: kein Ebenholz – Plastik! Plexi-Chrom-Chic der frühen Siebzigerjahre. Alsterblick. Sachliche Atmosphäre. Dorothee war – beruflich gesehen – aus der internationalen PR-Welt in die Bundesrepublik übergesiedelt, also fünf Straßen weiter, und so wurde sie durch uns Gastgeber in die Zange genommen, jedenfalls von der Sitzordnung her, denn sie war ja nun das, was hausintern bei den Angehörigen ihrer ehemaligen Wirkungsstätte bedeutsam ‚der deutsche Markt‘ hieß. Gehässigere sagten: ‚Fräulein Köhler‘.
Die vage Dämmerzeit zwischen schon leeren Kaffeetassen und noch leeren Sherrygläsern. Jeder saß mit seiner mut- oder missmutmachenden Auflistung vor sich. Endlose Zahlenfolgen, dieselben Zahlen auf allen gleichen Listen. Alles computererrechnet. Zuverlässig. Schlüssig. Knapp, nüchtern, prägnant. Ziffern – unbestreitbar, indiskutabel.
Plötzlich ein Jubelschrei: „Bitte! Bitte! Die siebenundzwanzig-dreihundertachtundsechzig*. Ist doch fabelhaft! 938 Stück hat die schon wieder gemacht. Und die Tendenz geht aufwärts. Eindeutig. Das sieht man ganz deutlich. Im letzten Jahr waren es nur zweitausend. Wenn jetzt noch das Weihnachtsgeschäft dazukommt … Diese Listen sind spannender als jedes Buch. Ich verlass’ mich jetzt nur noch auf Zahlen. Zahlen, Zahlen. Kein Rumgerede mehr. Nichts. Für mich gibt es nur noch Zahlen. O nein, die dreihundertneunundsechzig*! Schrecklich. Wir haben extra im letzten Augenblick noch die Pressekonferenz vor dem Konzert in Frankfurt auf die Beine gestellt. Ganz allein. Die Zentrale hat keinen Pfennig bezahlt. Im Fernsehen war er auch neulich, Viertel nach zwölf im Dritten – hochinteressant! Aber was soll ich da machen? Wie kann ich das rechtfertigen? 431 Stück. Nun helft mir doch auch mal! Nein, die kann ich nicht halten. Mein Vertrieb erlaubt mir das nicht. Eine so wundervolle Musik … Ich liebe diese Platte! … Schrecklich, aber wir müssen sie streichen. Im Frühjahr geb’ ich die gleich zu sechzehn Mark raus. Das ist eine typische Wiederveröffentlichungsplatte, die kommt erst noch richtig! Die macht noch mal
Beklommenes Schweigen. Und schon damals fing sie an, mir zu imponieren. Verstehen und Lieben dauert dann immer noch etwas länger. Die Stille wird durch einen energischen Schlag ihrer flachen Hand auf die Tischplatte beendet. „Jawohl“, sagte sie, „und ich stimme zu!“ – Na bitte! Den wichtigsten Verbündeten hat sie also schon.
* Die wirklichen Zahlen sind dem Autor bekannt.

Jetzt begehe ich den nächsten meiner geplanten Stilbrüche und schiebe den Beitrag ein, den ich im Herbst 1977 zu Dorothees Weggang von der ‚Deutschen Grammophon‘ verfasst habe. Er beschreibt sie und unsere Not mit ihr ganz gut, und eine windelweiche Lobhudelei, wie sie in drei Sätzen von anderen Kollegen und Vorgesetzten verlegen abgesondert wurde, war von mir ja ohnehin nicht zu erwarten.
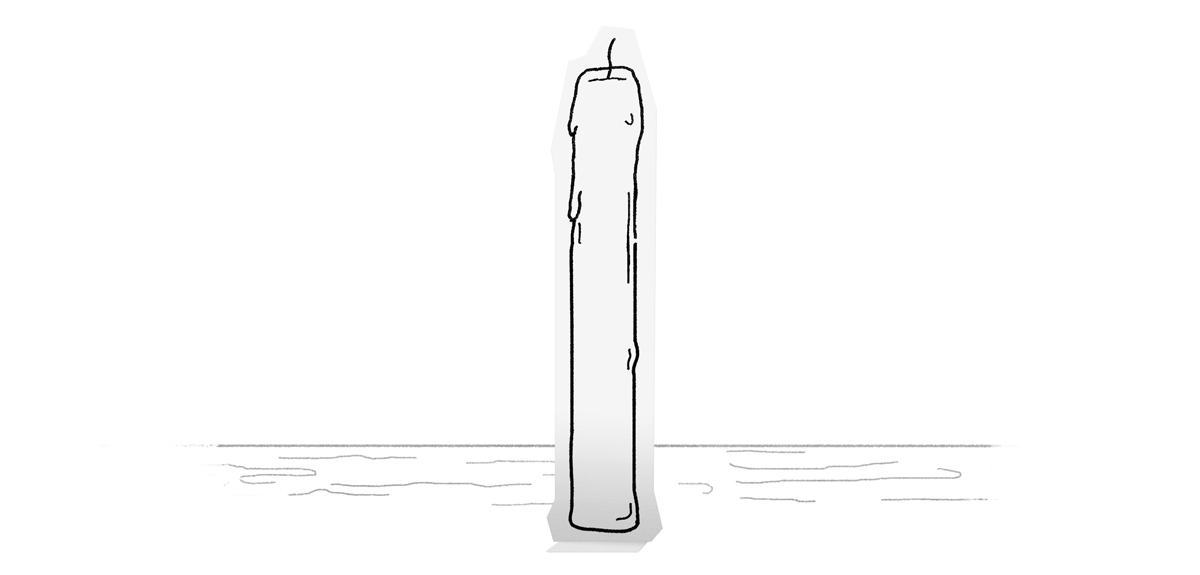
Titelgrafik mit Material von: Thomas Wolf/www.foto-tw.de/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DE (Landungsbrücken, Hamburg), Immo Wegmann/Unsplash (Schallplatte, hängend) und von Shutterstock: Aleachim (Schallplatten, Stapel), Gemenacom (Zeitungsstapel), Elnur (Papierstapel)

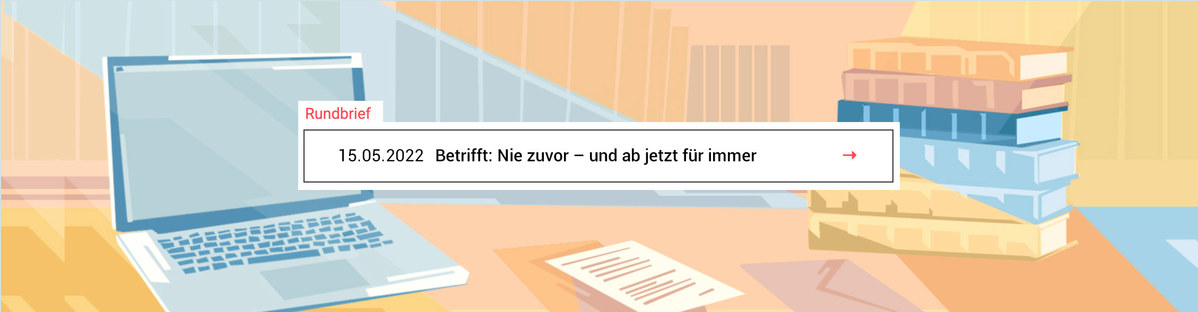







































































Vielleicht ein Zeichen dafür, dass erste Begegnungen doch nicht immer ausschlaggebend sein müssen…
Erste Begegnungen mit vorgefassten Erwartungen sind überschätzt. Erst bei der zweiten baut man die Vorurteile ab.
Im Guten wie im Schlechten. Die Menschen sind ja selten genau so, wie man sie im ersten Moment wahrnimmt.
Vor allem sind sie nur ganz selten so, wie wir sie gerne hätten.
Das ist nur dann schlimm, wenn man es zu spät merkt.
Oder auch wenn man trotzdem auf der eigenen Idee beharrt anstatt das Gegenüber so zu nehmen wie es tatsächlich ist.
Wow, der Markt für Tonträger hat sich seit Herbst 1977 ja auch nicht gerade verbessert. Da ist ja anscheinend kaum noch Geld mit zu holen.
Kleiner gewordene Firmen bedienen kleiner gewordene Märkte.
Solange sie überhaupt überleben können…
Es werden sicher deutlich weniger Firmen übrig geblieben sein. So geht es doch den meisten Branchen. COVID hat da nur den letzten Anstoss gegeben. Die Tendenz gab es schon vorher.
Hahaha, wenn zwischen der internationalen PR-Welt und der Bundesrepublik damals schon nur fünf Straßen lagen, na dann hat sich durch das Internet doch gar nicht so viel verändert 😉
Naja. Als Influencer musste ich damals viel mehr reisen.
Das war aber doch bestimmt viel spannender.
Spannender als der Schreibtisch? Ja, meistens.
Ich bin allerdings immer fasziniert davon, dass es heute erfolgreiche Social Media Influencer gibt, die sogar noch dafür bezahlt werden zu reisen und z.B. Hotels zu testen und auf ihren Kanälen zu bewerben. Digital muss also gar nicht immer nur Schreibtisch bedeuten.
So erfolgreich sind aber doch die wenigsten. Die meisten machen ein paar hübsche Fotos mit einem Haarshampoo in der Hand, das man „unbedingt haben muss“.
Ohne die professionellen Anpreisungen wären die meisten ‚must-haves‘ ganz normale Artikel, die keiner braucht.
Dass schon damals selbst bei Klassikaufnahmen die PR so wichtig war, ist ja doch auch eine Überraschung. Dabei sollte man denken, dass gerade die großen Komponisten und Dirigenten eh immer gehört würden.
Dass Beethoven gehört oder sogar als Billigplatte zu 7,50 DM gekauft wurde, hätte mein Gehalt nicht bezahlt.
Naja eben. Gerade weil man die ganzen Klassiker ja auch für wenig Geld bei Naxos bekommen kann, braucht es doch gutes Marketing um eine besondere, aufwendigere, hochwertigere Veröffentlichung an die Leute zu bringen. Das liegt doch auf der Hand.
Ich musste so tun, als würde die Musik erst durch unsere teuren Interpreten zum Genuss. Als Student hatte ich immer nach dem Preiswertesten gesucht. Ich studiere das Werk. Der Interpret war mir egal. Inzwischen schmecke ich durchaus den Unterschieden nach, aber das bleibt ein Vergnügen weniger, die dann oft Kritikern mehr vertrauen als ihrem eigenen Fachwissen.
Gerade bei den Klassikaufnahmen bin ich immer wieder erstaunt, wie sehr sich die Aufnahmen unterscheiden können. Mal sagt mir ein Werk gar nicht zu, dann wieder bin ich hin und weg.
Klare Pläne und klare Ziele sind ja generell wichtig, nicht nur bei Musikveröffentlichungen. Man darf das vielleicht nicht als starre Vorlage nehmen, aber eine Richtlinie braucht es ja doch um überhaupt voranzukommen.
Bei Literatur, Musik und Kunst gibt es künstlerische und kommerzielle Ziele. Sie sind nicht immer deckungsgleich. Werden die kommerziellen Ziele dabei vernachlässigt, droht die Pleite. Das hat sich auch im Niedergang des Sozialismus erwiesen.
Da ist dann aber auch immer die Frage wer sich letztendlich wem anpassen muss. Beharrt der Künstler auf seiner Vision oder setzt sich der Verlag mit einer alternativen, wohlmöglich lukrativeren Strategie durch.
Diese Diskrepanz wird immer bleiben, und sie ist sogar fruchtbar.
Außer es treibt den Künstler in eine Blockade.
Neulich las ich aber ein Interview mit dem Indie-Regisseur, der diesen neuen Wikingerfilm, der so gelobt wird, gedreht hat. Da fand ich z.B. spannend, wie er die Vorgaben und Einschränkungen des großen Hollywood-Filmstudios sogar als Bereicherung empfand. Er sagte so etwas, wie dass sein Film dadurch ein besserer geworden sei.
Unter drängenden Bedingungen ist schon oft ernsthaftere Kunst entstanden als unter uneingeschränkter Freiheit.
Was wäre ein Leben (eine Geschichte) ohne Brüche?
Sehr vorhersehbar.
Also unkommerziell!
Unwiderlegbare Unwiederbringlichkeit ist ja mal eine Wortschöpfung 😆
Wortschöpfungen sind mein Schönstes! (wie man liest…)
Wenn wirklich eine Aussage über irgendetwas auf jedem Blättchen steht, ist das doch was. In meinem Rucksack ist es meistens so, dass mindestens die Hälfte der Unterlagen und Notizen in den Müll kann.
Na dann wird es aber mal Zeit fürs Ausmisten, nicht?!
Man weiss ja nie wofür so Notizen nochmal gut sind. Rumtragen würde ich sie deswegen aber auch nicht ständig.
Alles ist eine Aussage über irgendetwas, auch eine ungültige Telefonnummer oder Goethes Weinrechnung. Man muss nur aufpassen, nicht zum Informations-Messie zu werden. Andererseits hätte ich ohne meine ausufernde Informations-Sammlung meine Filme und Schriften nicht erstellen können.
Ja das ist ein guter Punkt. Gerade, wo man doch eh vieles googeln kann, sollten sich die eigenen Notizen doch erheblich reduzieren lassen.
Das Unergooglebare gewinnt eine neue Bedeutung …
Mittlerweile bietet es sich ja auch an die Notizen einfach ins Smartphone zu tippen. Das macht die Tasche um einiges leichter. Aber das bleibt wahrscheinlich eine Typfrage.
Ja genau. Ich brauche immer noch mein Notizbuch, wenn es darum geht Ideen zu sammeln. Das Handy benutze ich für alles andere.
+1