20. November 2003
Ankunft in der Pension Dittberner, Wielandstraße, fast Ku’damm
Der große, alte Fahrstuhl mit seinem schmiedeeisernen Tor ist mir noch nie so geräuschlos vorgekommen, die Gänge noch nie so verwinkelt. Die Beherbergung im dritten Stock muss sich ihr Flussbett durch mindestens drei Gründerzeithäuser graben. Ich habe das allerletzte Zimmer. Oder das allererste. In meinem eigenen Flur, hinter einem Vorhang versteckt sich die verschlossene Eingangstür zu der ehemaligen Wohnung, die jetzt mein Quartier ist und in der einst ein jüdischer Verleger oder ein SS-Standarten-Führer mit Familie gewohnt haben mag. Vielleicht haben beide, nacheinander, dort ihre trügerische Zuflucht gesucht. Sie hatten ein großes Bad mit zwei Fenstern, und in ihrem Wohnzimmer steht neben zwei Ohrensesseln und einem Schreibtisch das breite Bett, das weiß, wie allein ich komme: Es hält nur ein Kissen und eine Decke bereit. Die leere Hälfte lässt das Laken nackt erscheinen.
Ich befreie Hemden, Hose und Jacke aus der etwas konturlosen Tasche, sie danken es mir mit Faltenlosigkeit. Mein bedeutsames Manuskript vertraue ich dem Tisch so schwungvoll an, dass die Vase umkippt: ausnahmsweise echte Blumen mit echtem Wasser, ungewöhnlich für diese Umgebung. Netterweise breitet sich die Flüssigkeit Richtung Stoff aus und nicht Richtung Papier. Wörter sind ein empfindlicheres Material als Kaschmir.
Ein paar Telefongespräche, vor allem das mit Dorothee. Sie redet wie im Fieber, und das kommt so:
Vor drei Wochen rief Dorothee mich an, um mich zu fragen, ob ich wüsste, dass in der Philharmonie Bernsteins ‚Mass‘ aufgeführt würde und dass zu diesem Ereignis auch Harry Kraut erwartet würde. Ich weiß grundsätzlich nie etwas, was Dorothee mir erzählt. Natürlich habe ich keine Ahnung, wo in Berlin die Musik spielt, die Ausstellungen eröffnen und die Autoren lesen. Aber auch über Beerdigungen in meiner unmittelbaren Nachbarschaft ist Dorothee wesentlich besser orientiert als ich. Es würde mich nicht im Mindesten überraschen, wenn sie mich eines Morgens anriefe, um mich darauf aufmerksam zu machen, dass in meinem Edeka-Laden an der Bernadottestraße heute Kochäpfel im Sonderangebot auslägen.
Prompt bekam ich am nächsten Tag eine E-Mail von Harry, die alles, was Dorothee gesagt hatte, bestätigte, gewürzt durch die Frage, ob ich mit ihm in das Konzert gehen wolle. Die Antwort darauf war einfach: In das Konzert wollte ich nicht, nach Berlin ja. Also mailte ich zurück, dass ich sehr gern mit ihm ins Konzert gehen würde: Es waren noch zwanzig Tage Zeit, und ich hatte schon etwas Pinot Grigio getrunken. Zusagen zu machen, nachdem man sich eine zarte Beschwingtheit angeschwipst hat, ist genauso verhängnisvoll wie mit leerem Magen Lebensmittel einzukaufen: Der Sinn für Proportionen lässt sich vom Übergewicht der freudigen Erwartung einwickeln, egal, ob es um Verabredungen oder um die Wurst geht. Nachher, nüchtern, kann man weder die Gäste ausladen noch den Camembert zurückbringen, man kann allenfalls so viele Schlucke nachgießen, bis man sich den Einverständnis-Pegel wieder zurückerobert hat.
Nicht alle erwarten so ‚gern‘, wie das Mitropa-Team es in den Fernzügen per Lautsprecher kundtut, aber ich habe da doch zwei grundverschiedene Temperamente ausgemacht: Die einen bestehen auch nach dem Genuss einer Literflasche Absolut-Wodka darauf, dass sie nicht mehr als vier Menschen einladen können, weil ihnen aus dem sechsteiligen Rosenthal-Service neulich ein Teller runtergefallen ist; die anderen umgeben sich mit Menschen so üppig wie mit Modeschmuck, lassen aus Plastikbechern trinken und bestellen, immer wenn es knapp wird, beim Pizza-Service nach. Dorothee gehört in beide Kategorien nicht, und zwar in einer Weise, die nur ihr möglich ist, nämlich so, dass sie vehement beide Kategorien miteinander vereint und den Widerspruch vom Messerbänkchen bis zum Pappteller zunächst in sich, dann vor anderen austobt: Aus intimen Tête-à-Têtes werden Stehpartys in der Küche, und aus ausschweifenden Gelagen werden behagliche Dreier; dies alles natürlich Wochen, bevor der erste Gast den Klingelknopf gedrückt hat – gesprächsweise. Noch brisanter als die Gästeliste ist die Speisenfolge, normalerweise, diesmal allerdings nicht, denn es stand fest, dass es ‚(Rheinischen?) Sauerbraten‘ geben sollte, den habe sich Harry so dringend gewünscht. Diese noch nie zuvor erlebte Eindeutigkeit wurde eigentlich nur durch drei Probleme beeinträchtigt. Erstens: An welchem Tag sollte die Abfütterung erfolgen? (Passen tat wegen Dorothees anderweitiger Verpflichtungen keiner.) Zweitens: Wen kann, wen muss und wen möchte man dazubitten, dies allerdings auch im Hinblick auf den Sechs-Personen-Tisch. Und drittens: Wie macht man Sauerbraten? – Die erste Frage wurde an zehn Tagen telefonisch mit mir erörtert – die Imponderabilien waren aber auch gewaltig. Harry, dem das Beisammensein mit Prominenz nach wie vor am Herzen liegt, wollte sich einen Abend für Kent Nagano, den Dirigenten der Veranstaltung, freihalten, einen Abend also, an dem der jugendliche Maestro – alles andere hintanstellend – sich vom weisen Harry darüber unterrichten lassen würde, was Bernstein und eine Harke sind.
Dorothee hatte sich für ihr Essen den 19.11. ausgeguckt, weil am Abend des 20. eine Einführung in das neue Werk von Wolfgang Rihm stattfinden sollte, zu der ‚alle‘ gehen wollten, Dorothee selbst natürlich als Erste. Mir war das recht, denn ich wollte an diesem 20. November bei meiner Cousine Marina deren Geburtstag feiern, zum ersten Mal seit 1967 und, wie sie angekündigt hatte, mit einer Gans, die ich mir sowohl unhandlicher als auch knuspriger vorstellte als einen Sauerbraten. Zu der Freude, mein genetisches Umfeld zu treffen, kam hinzu, dass ich gleich eine triftige Ausrede hatte, mich in ein Werk nicht ‚einführen‘ zu lassen (ich sehe da schon das Thermometer rektal), das ich mit Sicherheit anschließend nicht hören mochte.
Zwar bin ich Manns genug, mich auch ohne Gans zu sträuben, mir einen solchen Ohrenschmaus und sein vorab gereichtes Rezept anzutun, aber es hätte Dorothee, die mich gar zu gern dabeigehabt hätte, verletzt, und das musste ja nicht sein. Schon mein Fernbleiben der Biennale in Venedig hatte ihr Fassungsvermögen auf eine harte Probe gestellt. Ich war dann zwar noch ein zweites Mal im Sommer in Venedig gewesen, aber auch bloß zu Peggy Guggenheim gegangen.
Heimlich beabsichtigte ich, am 19.11. noch nicht in Berlin einzutreffen, was Dorothee beizubringen, meine ganze Kraft erfordern würde. Doch mein Lieblingsdichter Wilhelm Busch wusste ja schon: ‚Aber hier, wie überhaupt, kommt es anders als man glaubt‘1, denn der 19. wurde nun der Kent-Nagano-Abend, sodass Dorothee auf Rihm verzichten und sich für ihre Einladung mit dem 20. begnügen musste. Sie rang fernmündlich die Hände, dass ich nicht dazustoßen würde, doch blieb ich hartleibig, in Erwartung von Gans und Cousine. Sie habe fest mit mir gerechnet, jammerte Dorothee, es käme ja auch sonst niemand, die wären doch alle, alle bei Rihm. Ich nahm mir schon mal vor, mich auf meinem Weg nach Zehlendorf zu Marina und Florian nicht zu wundern, wenn die Straßen wie ausgestorben wären, als ob die deutschen Fußballdamen gegen die Färöer Nationalmannschaft anträte, weil ich ja wusste, dass sich zur gleichen Zeit ganz Berlin in Rihm einführen ließ.
Im Laufe der Zeit kratzte Dorothee dann aber doch den ein oder anderen Namen zusammen, natürlich lauter ungeeignete Leute: Kein Wunder – wer den Papst am Karfreitag zum Spanferkel-Essen einlädt, braucht sich nicht zu wundern, wenn bloß Protestanten kommen. Jedenfalls schienen ihre Messerbänkchen dennoch ausgelastet, während ich Berlin entgegenfuhr.
Das Wann-und-wer war allerdings eine Petitesse im Vergleich zu dem Problem, wie ein Sauerbraten herzustellen sei. Unsere täglichen Telefonate zwischen Hamburg und Berlin drehten sich dermaßen im Kreise, dass einem ganz schwindelig werden konnte.

Wie so oft mache ich etwas, was nicht geht: Ich springe jetzt, genau zur Hälfte meiner Berlin-Reise, in die Zukunft. In dieser Zukunft wird mir ein Ausstellungsbesuch mit Dorothee wie ein Déjà-vu vorkommen, weil ich mich an den eben beschriebenen erinnern werde. Wie so oft ist die Vorgeschichte spannender als die Geschichte selbst, und ich lasse wirklich alles weg, was nichts zur Sache tut. Aber ganz verzichten mag ich zum Wohl meiner Lesenden auf die Episode nicht. Es geht um Kunst, Musik und Beköstigung. Bernstein ist seit dreizehn Jahren tot, sein langjähriger General Manager Harry Kraut lebt noch, überwiegend zur Wahrung und Kommerzialisierung von Bernsteins Angedenken. Dorothee ist in einer ihrer vielen Funktionen Harrys PR-Bevollmächtigte für Europa, ich war nicht mehr sein Geschäftspartner, aber immer noch sein Freund. Um Harry geht es hier also oder um Dorothee oder wie üblich: um alles!
Quelle: 1 Wilhelm Busch: ‚Plisch und Plum‘ (Auszug), 1882

Titelbild mit Material von Fridolin freudenfett/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
#2.32 (A) | Därme aus Zinn#2.32 (C) | Telefongespräche zwischen Berlin und Hamburg über Sauerbraten

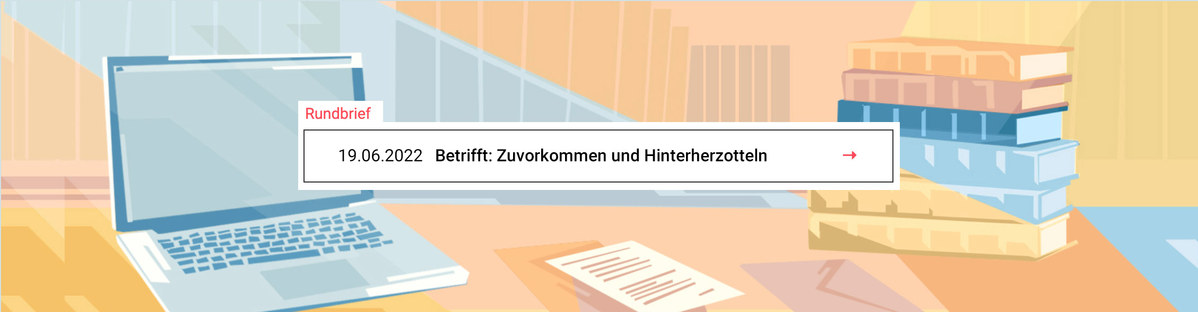







































































Ach wirklich? Busch hätte ich nicht so schnell mit Ihnen in Verbindung gebracht.
Seine lakonischen Bemerkungen über menschliche Schwächen gefallen mir. Sein latenter Antisemitismus weniger.
Oh über sein Privatleben weiss ich gar nicht viel. Das ist schade zu hören.
Schade ist vielleicht das falsche Wort. Aber über die Nazi-Vergangenheit bedeutender Künstler gibt es ja leider viel zu viel zu sagen.
Ich beziehe mich auf ‚Plisch und Plum‘:
Kurz die Hose, lang der Rock,
Krumm die Nase und der Stock,
Augen schwarz und Seele grau,
Hut nach hinten, Miene schlau –
So ist Schmulchen Schievelbeiner.
(Schöner ist doch unsereiner!)
Allerdings beschreibt Busch auch rein niedersächsische Figuren nicht gnädiger.
Was soll man eigentlich über den Antisemitismus-Skandal der Documenta denken? Ich habe das Wandbild selbst nicht gesehen. Ist die Kritik berechtigt oder wird da doch nur wieder ein Dialog zwischen verschiedenen Meinungen unterbunden?
Mich wundert ja ehrlich gesagt, dass dieses Künstlerkollektiv bzw. dieses Werk ohne jegliche kritische Auseinandersetzung eingeladen wurde.
Die Verantwortlichen wollten wieder so vorurteilsfrei aufgeschlossen sein. Geschichtsbewusste Europäer, Deutsche allemal, schämen sich ihrer Vergangenheit und müssen die Welt ständig um Verzeihung bitten.
Ea geht wie üblich um alles! Haha, na dann…
Weniger wäre oberflächlich.
Faltenlosigkeit auf Reisen ist nach wie vor eine meiner großen Herausforderungen. Wer dafür einen Geheimtip hat … außer alles bei Ankunft zu waschen und zu bügeln … der kann mir wahnsinnig gerne Bescheid sagen.
Ich rolle meine Wäsche im Koffer anstatt zu falten. Es hilft tatsächlich ein wenig. Nicht nur wenn es um die Menge geht…
So hat Pali es auch immer gemacht. Ich vertraute darauf, dass Leinen ‚edel‘ knittert, glaubte mir dann aber doch nicht.
Man muss ja auch nicht nur sich selbst sondern auch noch alle anderen überzeugen.
Werke, die vorab eine Einführung brauchen, sind mir eh immer suspekt. Wofür?
Weil manche Menschen leichter Zugang finden, wenn sie ein paar Informationen haben. Andere lassen sich eben lieber überraschen. Wo ist denn das Problem?
Manches erschließt sich leichter mit ein paar Hinweisen. Bildende Kunst und Musik vor allem. Literatur und Film sollten möglichst ohne zusätzliche Erklärungen auskommen können.
Man muss aber auch nicht alles erklären (müssen).
Anderen nicht, sich schon.