

„Ich gehe oft hier spazieren“, sagt Marion. Auf der Grenze? Oder der Grenzenlosigkeit. Oder wegen des unverwalteten Grüns, Brauns und Graus, das den Straßen und Ampeln mitten in der Stadt Einhalt gebietet wie in Hamburg die Alster. Lustig, die seidenbetuchte, ihre ganze Stadt prägende Alster mit dieser willkürlichen, zerzausten Fläche zu vergleichen, deren Kopfgeburt zum Hirngespinst verstorben ist. Eine Dame steht einer Punkerin gegenüber. Beide sind sprachlos.
„Fabelhaft“, sagte Dorothee, „ich finde das ganz fabelhaft. Das kannt’ ich noch gar nicht. Wo steht dein Auto?“
Es stand am Wegesrand eingepfercht zwischen seinesgleichen. Wir passten, wenn auch beengt, alle drei rein. Besser die Knie am Kinn als den Arsch in der Wohnlandschaft. Kaum dass Marion losfuhr, fing es allerdings dermaßen an zu gießen, dass ich meine Schilderung nicht fortsetzen kann, jedenfalls aus keinem Blickwinkel heraus, bloß akustisch.
„Da, das geht doch! – Sieh mal da! – Hier ist was!“, das waren Dorothees Anfeuerungen, wenn in den Autoketten rund um die Kantsteinbordüre des Käthe-Kollwitz-Platzes eine Lücke auftauchte. Dass es sich ausschließlich um Ausfahrten (Optimisten nennen sie: Einfahrten) handelte, mochten wir der führerscheinlosen Dorothee nicht beibringen. Fußgänger, die sich im Recht wissen, sind sowieso gefährdet. Die angrenzende Husemannstraße, benannt nach dem prominentesten Architekten der DDR, wurde schon zu DEFA-Zeiten hergerichtet und als Kulisse für historische und zeitgenössische Filme ge- oder missbraucht, so eine Art ‚Innenstelle Babelsberg‘. Inzwischen ist sie vom Kapitalismus überschwemmt und zugeparkt.
Wir waren schon dreimal an dem verheißenen Lokal vorbeigekurvt und von Marion ermuntert worden auszusteigen, aber Dorothee lehnte das in einer Mischung aus Vasallentreue und Preußentum ab, ich hatte keine eigene Tür, somit keine andere Wahl, und unterstütze Dorothee lauthals, wie Mitläufer, die keine Folgen fürchten, das so tun. Marion manövrierte uns schließlich in eine Lücke, die an einer verkehrsbehindernden, parkverbotenen Stelle vermutlich dadurch entstanden war, dass ein nervenschwacher Autobesitzer aus Angst vorm Abschleppdienst sein Date soeben abgebrochen hatte.
Ich mag es nicht so gerne, wenn ich in einem ‚Ristorante Roma‘, um vor den Gästen anzugeben, in Italienisch zu bestellen anfange und der kroatische Kellner mich unterbricht: „Sie sagen Deutsch, bitte.“ Lieber habe ich es, in einem asiatischen Lokal auch unter den Gästen Mandelaugen zu entdecken, selbst wenn ich einkalkuliere, dass ein Indonesier seinem japanischen Wirt dessen Küche genauso wenig ansieht wie ein Spanier einem Türken. Ganz abgesehen davon, dass ich, wenn mich in Buenos Aires das Heimweh packt, sowieso in die ‚Bodega Edelweiß‘ gehen muss, weil eine andere Wahl nicht gegeben ist.
„Das ist doch toll hier“, machte Dorothee sich Mut. Die Bedienungen sahen in der Tat zwillingshaft siamesisch aus. Die Hungrigen waren in unübersichtlicher Vielfalt erschienen, und unser Tisch war, falls es ihn überhaupt gab, nicht frei. Wir wurden mit der berühmten Lächel-Taktik lahmgestellt und dann mit einem Prosecco-Angebot mundtot gemacht. Nur ich schlug es zähneknirschend aus, tröstete mich aber damit, dass Prosecco hierhergehörte wie Buddha in den Vatikan.
Nach zwanzig Minuten, stehend in drangvoller Enge, wurde uns die Wahl gelassen, weiter zu warten oder einen Mitteltisch im Keller zu beziehen. Die liebenswürdige Asiatin sagte natürlich nicht ‚Keller‘, sondern zwitscherte mit zierlicher Handbewegung: „Dort unten“.
„Ja“, sagte Dorothee, „oben ist es netter.“
Mich reizte, dass ‚dort unten‘ auf Höhe des Gehwegs ein bis ins Parterre hinaufreichendes Fenster begann; so konnte man die Straße aus dem für Menschen ungewohnten Blickwinkel einer Kanalratte beobachten.
Es regnete wirklich sehr.
„Also, lass uns den Tisch nehmen!“, sagte ich. In welchem Loch man eine Mahlzeit ohne Wein wegschluckt, fand ich unerheblich.
Ich hämmerte mir ein, dass Tee zu diesem Essen besser passt als alles andere und beachtete den Wein an unserem und an den Nachbartischen weniger als die Beine der Passanten.
Dorothee konnte nur meinen Seitenblicken folgen, sie hatte sich mit dem Rücken, also einem Anflug von Opposition, zum Fenster gesetzt. „Sehr bürgerliches Publikum“, sagte sie, „aber nett.“
Ich wusste, sie hatte sich von der Gegend mehr Grünhaarige erhofft, aber das ist vorbei. Seit die Mitte behände den Prenzlauer Berg raufgekraxelt ist, wurde die Filmkulisse natürlich das erste Terrain, das die neue Mitte für Staatsbesuche sondierte. Schräg gegenüber unserem Thai-Lokal für die Kleinfamilien von Ministerialratssekretärinnen hat Schröder mit Clinton Zwiebelkuchen gegessen. Das wusste ich von Michael, mit dem Giuseppe und ich nach dem ‚Abendmahl‘ hier noch einen Edelzwicker (auch 70er-Modell) tranken, zehn Jahre, nachdem Michael und Jürgen mir die Gegend noch als ‚DDR pur‘ hatten präsentieren können.
Unser Essen und unsere Unterhaltung waren würzig, aber leicht verdaulich. Dorothee, Marion und ich lächelten nur geringfügig weniger als die Bedienungen; bei der Verabschiedung übertrafen wir sie sogar an Spontaneität.
An der Restauranttür, wegversperrend für alle, halb draußen im Nassen, das Übliche:
Marion: „‚Tante‘ (!) Dorothee, ich bring’ dich nach Haus’!“
Dorothee: „Neeeiiin, ich fahr’ mit der Straßenbahn, so was gibt es doch im Westen gar nicht mehr. Die Linie 1 hält gleich hier um die Ecke, dann krieg’ ich am Rosenthaler Platz den 340er. Zinnowitzer Straße kann ich die U6 nehmen und steig’ Friedrichstraße um in die S-Bahn, ganz einfach.“
Marion: „Dann kann ich dich doch gleich bis zur Friedrichstraße bringen.“
Dorothee: „Nein.“
Marion: „Doch!“
Dorothee: „Na schön, aber bei dem Verkehr dauert es mit dem Auto bestimmt länger.“
Marion: „Der Bus steht auch im Stau.“
Dorothee: „Nein, der hat eine eigene Spur.“
Marion: „Nur im Westen.“
Dorothee: „Ach, ja?“
Ich: „Ach, wenn Sie schon zur Friedrichstraße fahren, könnten Sie mich wohl anschließend bei meinem Hotel absetzen?“
Marion hielt zunächst am Bahnhof und drei Minuten später vorm ‚Madison Suites‘. Sie war jung und florentinisch schön, ich war nicht jung und bettreif. Das, worauf man sich nicht einlässt, bedeutet einem nicht genug.
„Vielen Dank“, sagte ich, „gute Nacht!“
„Gute Nacht!“, sagte sie.
Damit begaben wir uns, freundlich winkend, aus dem Leben des anderen.

Titelbild mit Material von Fridolin freudenfett/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

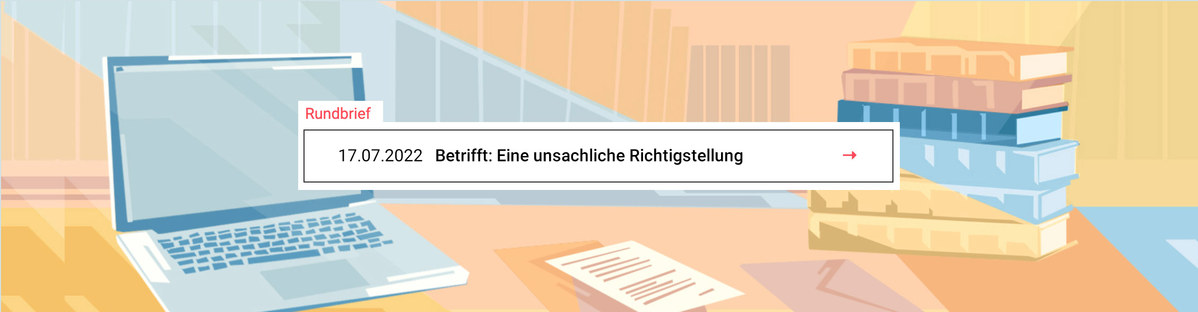







































































Florentinisch schön klingt so wunderbar
Ist blond, nicht dunkelhaarig.
Auch Optimisten fahren ab und an aus der Einfahrt heraus 🤷🏻♂️
Und in die Ausfahrt hinein?
Die Innenwelt der Außenwelt.
In Prenzlberg gibt es wirklich kaum noch Zeichen der alternativen Szene der frühen 90er. Das meiste ist genauso gentrifiziert, wie jeder andere Ort.
Fortschritt kann man bedauern oder hinnehmen. Oder gegen Windmühlenflügel ankämpfen: Beim Atom-Ausstieg hat’s ja auch geklappt.
Bei Atomkraft bin ich auch verwirrt. Ist sie nun der Teufel oder unser Retter?
Sie ist momentan das kleinere Übel
Ob Teufel oder Retter hat im Laufe der Geschichte schon häufiger eine Umdeutung erfahren. Kommt auch drauf an, ob man angegriffen wird oder gerade schön siegt.
Gerade bei Atomkraft gehen die Sicht- und Herangehensweisen der unterschiedlichen Länder ja auch weit auseinander. Wenn Putin es noch ernster meint, als man bereits ahnt, dann werden wir uns noch ärgern und so abhängig gemacht zu haben.
Stimmt das mit den Bussen? Im ehemaligen Westen gibt es eine Extra-Spur und im Osten nicht?
Dabei sollten doch eine ganz Menge neuer Busspuren geschaffen werden. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Was geschaffen werden soll, muss erst mal durch die Gremien.
Dass man sich mit so einem kleinen Abschied möglicherweise aus dem Leben eines Anderen bewegt – ein starkes Bild!
Und passiert relativ oft.
Wer vor seinen Freunden angibt, wird eben bestraft 😉 Im Zweifel halt von einem kroatischen Kellner.
Ach sowas gehört doch dazu. Wann soll man denn auch sonst seine Fremdsprachen-Kenntnisse nutzen!?
Bei Speisekarten bin ich ausgesprochen vielsprachig.
Prosecco gibt es ja auch in jedem zweiten deutschen Lokal. Da gehört der ähnlich wenig hin, wie nach Vietnam.
Also, Schwabing liegt doch etwas dichter am Veneto als Hanoi.
Das ist wohl richtig, aber trotzdem trinkt man ja auf dem Oktoberfest auch kein Kölsch.
Getränke bestehen ja nicht nur aus dem, was man schluckt, sondern auch aus dem, was man damit verbindet. Den Glamour von Champagner, das Florida-Feeling der Margaritas, den Winter-Spaziergang mit Doppelkorn zum Eisbein.- Wer genießt schon nichts als die Flüssigkeit?