1–2 Lothar Probst/Quelle (auch 3): ‚Der Spiegel‘ – ‚Schöne Kombination‘, vom 13.08.2000

Donnerstag, 20. Juli
Ein Tag, der so viel bewirken sollte und so wenig bewirkt hat, damals: 1944. Meine Eltern berichten, wie enttäuscht sie waren, und meine Mutter fügt im Allgemeinen noch hinzu, dass sie, wenn sie die Chance dazu gehabt hätte, weniger halbherzig vorgegangen wäre. Aber sie war ja nun mal nicht in der Wolfsschanze, sondern in Berlin, und so konnte sie ihre Einsatzfreude nicht unter Beweis stellen, ja nicht einmal verhindern, dass der Widerstand in der Hauptstadt zusammenbrach. Wäre eine Regierung mit ‚Reichsverweser‘ Beck besser für die Westdeutschen gewesen als das, was kam? Die Wertvorstellungen der gescheiterten Putschisten sind mir nicht geheuer. Das Berliner Schloss und so manches Andere stünde sicher noch. Der große Wohlstand, einhergehend mit amerikanischer Lebensweise, hätte nicht stattgefunden. Vielleicht nicht einmal die Teilung Deutschlands, die wurde erst im Februar ’45 auf Jalta beschlossen. Was schwerer wiegt: Vom 20. Juli bis Kriegsende starben mehr Menschen als vom September ’39 bis zum Tag des Scheiterns. – Müßig. Und ich denke, die Menschen meiner Generation, die den verlorenen Krieg nicht unmittelbar ausbaden mussten, sind klammheimlich froh über ihre Jugendzeit in der Bonner Republik mit dem vorwitzigen Insel-Berlin, einer Stadt, die sich gewaschen hat; aber auch in der Bundesrepublik ging es ja ohne den wertkonservativen Verweser zunächst mal ungeheuer reinlich zu. Adenauer, Wehner, Brandt, selbst Kohl noch während seiner Amtszeit, sie alle standen für ‚Werte‘, die nicht an der Börse gehandelt wurden. Bonn war immer noch Gesinnung, das neue Berlin ist es – Gott sei Dank? – nicht mehr. Die Preußen-Hauptstadt stand – zum Entsetzen der anderen Monarchien – immer zum Pragmatismus: Jude, Katholik, Neger (sag’ ich mal) – Hauptsache, er zahlte Steuern. Wer den Staat anerkannte, wurde anerkannt. Preußen war Anfang des neunzehnten Jahrhunderts der modernste Staat Europas und wurde dann geradezu ‚in‘ (Sebastian Haffner nennt es Ende der Siebzigerjahre noch ‚chic‘); es zeugte von der völligen Ignoranz der Alliierten, ausgerechnet jenem durch das neudeutsche Kaiserreich infrage gestellten und durch die Nazis ausgelöschten Staatsgebilde die Kriegsschuld anzuhängen. Aber – Gerechtigkeit soll sein – die Alliierten mussten ja siegen, nicht denken.
Der Satz ist so blöd, dass ich ihn in meiner Schrift sehen will: Berlin ist nicht Bonn. Und die Furcht vor einem vierten Reich hielt ich immer schon für hysterisch. Selbst die meisten zunächst entgeisterten Intellektuellen scheinen sich ‚10 Jahre danach‘ damit abgefunden zu haben, dass es wieder ein auch so genanntes Deutschland gibt – und was für eins! Spaß und Spiel sind angesagt, auch in der Politik. Jeder darf mit jedem, sogar Kohl mit Gysi, und das noch unter vier Augen, hier in Berlin. Auch in der Politik ist ein spielerisches Element gefragt. Erfolgreiches, wendiges Management macht bei immer mehr Wählern immer mehr Punkte. Mehr als richtige Gesinnung. Die parteipolitischen Zuordnungsrituale aus Bonn – wir, die Guten; ihr, die Bösen – wirken immer verkrampfter und altmodischer. ‚Die Anzahl der Traditionswähler ist so weit geschrumpft, dass sie immer weniger wahlentscheidend ist‘1, lese ich. ‚Stark gewachsen‘, lese ich weiter, sei dagegen ‚das Spektrum der unberechenbaren, flexiblen und mobilen Wähler, die je nach Stimmungslage kontext- und situationsbezogen wählen.‘2 ‚Da ordnen sich Richtungen oft völlig neu‘, befindet Angela Merkel.3
Ich trete federn auf die Straße. Eine Stadt, die sich gewaschen hat? Forget it! Am Wegesrand: Fast-Food-Müll statt Blumen. Geschmiere, selbst auf den Parkbänken: ‚Fuck PDS!‘ – Willkommen in Berlin! Ich wippe etwas schief, aber ich hinke nicht.
Der Apotheker fragt mich gleich nach meinem Fuß. In die Tüte mit meinem Reiseproviant steckt er nicht nur ein Paket Tempo-Taschentücher, sondern bereichert sie auch mit einem Buch. ‚Sieben Spaziergänge rund um den Bahnhof Friedrichstraße‘. Er wird von Mal zu Mal freigiebiger. Dabei sieht er überwiegend meine Gehbeschwerden. Wenn ihm erst meine Magenprobleme bewusster werden, wird er mir sicher auch einen Speiseführer schenken: ‚Sieben Garküchen rund um Aschinger‘.
Alles ist fast schon so familiär wie auf dem Dorf: an der Ecke der Bäcker, zu dem ich nicht gehe. Daneben der Bank-Automat, an dem ich mein Geld einkaufe. Die Buchhandlung, in der ich neben dem ‚Schweigen der Sirenen‘ für 23,79 DM noch die ‚Liebesfluchten‘ erstehe. Der Preis für die CD ist so krumm, weil er ein Prozentsatz vom MC-Preis sei, klärt mich die Verkäuferin wenig erhellend auf. Das Lebensmittelgeschäft, von dem ich einen neuen Sechser-Pack Wasser anschleppe; unter den Arm geklemmt: frische Astern, weil ich heute Abend Besuch erwarte. Astern sind nicht schön, aber dankbar. Ich auch – die Sonne kommt zum Vorscheinen. Meinen schmalen Balkon streift sie nur flüchtig und konzentriert sich lieber auf die Balkone der oberen Geschosse, aber das macht nichts: Wenn ich meine Bettdecke als Strandbad auf den Fußboden lege und mich selbst nackt darauf, jubelt gleißendes Julilicht durchs geöffnete Mittelfenster und senkt sich als Sommerchoral auf meine Haut. Braunwerden dauert bei mir genauso mühsam lange wie Sprachenlernen, nur dass die Haut noch vergesslicher ist als das Hirn.
Schon mit sechzehn war es mir wichtig, ab Ostern jede Möglichkeit zu nutzen, mir mittels Bräune ein sportlicheres Aussehen zu geben, als meine Muskeln hergaben. Mit meinen Nachbarinnen ging ich an die nahe Elbe. Das war bequemer als Liegestütze. Auch auf Föhr, im Schullandheim, mochte ich die kuscheligen Gräben und die Felder lieber als den Fußballplatz. Mochten die anderen Buben Tore schießen – ich holte mir auf hartem Grund Mückenstich und Sonnenbrand. Einmal musste sogar der Arzt kommen, das brauchte er bei den Fußballern nie.
Gegen fünf ging die Sonne weg, ich auch. Auf der Straße war sie ja noch. Ich wanderte von der Mohrenstraße über die Gräfin Voß zum Potsdamer Platz: Großstadtsommer einatmen. Was macht man auf großen Plätzen, wenn man keinen Wein trinkt? Im Angebot der Läden und Cafés stocherte ich rum wie in einem Becher Knoblaucheis nach leckeren Stückchen. So verfiel ich wieder auf das 3D-Kino. Ich wollte das noch mal sehen. Nicht nur ich – Massenansturm! Im Zickzack wurde ich eine Barriere entlanggenötigt. Die Leute drängten sich, eine Sauriergeschichte zu sehen, ich mittenmang.
Die Story war noch dünnblütiger als die Geschichte vom Jungen, der nach New York kommt, und geht so: Ein Paläontologe kratzt und schabt im Gestein herum. Er findet einen Abdruck. Seine begeisterte Tochter bringt ihm Stullen vom nahen Camp. Sie soll etwas weniger Gefährliches erlernen als der Vater, was sie ärgert. Das Gefährliche sind natürlich nicht die Spuren im Felsen, sondern die Risse: Kaum rutscht man ab – schon ist man tot. Nachts träumt die Tochter, die Kamera mit. Das hat zur Folge, dass mir (als optische Täuschung wegen meiner 3D-Brille) ein Saurier viermal ins Gesicht trampelt. Einige der Frauen, denen das auch geschieht, juchzen. So was ist Bestimmung: Nun darf die Tochter auch Paläontologie studieren, was ihr, wenn sie später mal nach ihrem Beruf gefragt wird, eine wirkungsvollere Antwort ermöglicht als ‚Hausfrau‘. Wir stehen benommen auf und tappen wie Dinos in die Ladenpassage zurück. Ein Klo ist rasch gefunden, dann wird es auch langsam Zeit, sich zu beeilen.

Titelbild mit Material von Michael.F.H.Barth/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

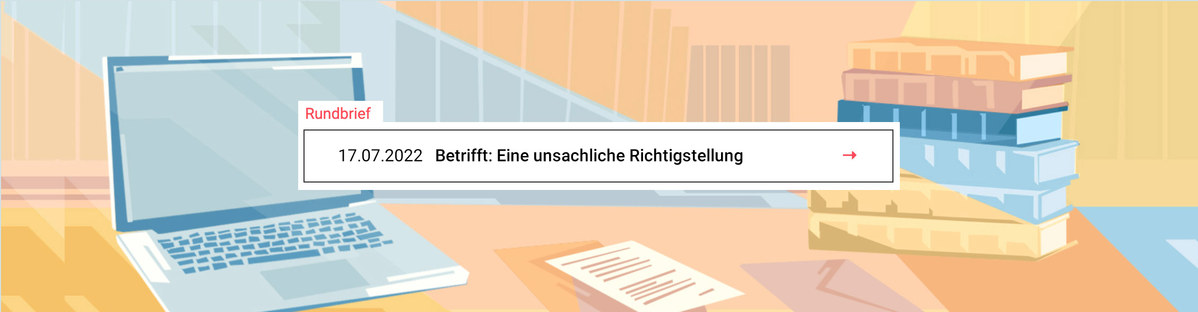







































































Ein Viertes Reich wird es wohl hoffentlich nie geben. Aber man hätte auch nicht gedacht, dass Europa mal in einen offenen Krieg mit Russland schlittern könnte oder dass die USA möglicherweise nach der nächsten Wahl keine Demokratie mehr sind.
Na, dass die USA mit Trump keine Demokratie mehr wären, ist wohl doch übertrieben. Hitlers Ermächtigungsgesetz bekäme er nicht durch den Kongress.
Der Supreme Court entscheidet nach der Sommerpause ob die Wahlmänner der einzelnen Staaten im Zweifelsfall ihre Stimmen so verteilen können, wie sie es für richtig halten. Auch unabhängig vom Wahlergebnis. Das klingt ähnlich demokratisch wie Putin oder Erdogan.
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/07/01/democracy-advocates-raise-alarm-after-supreme-court-takes-election-case/
Das Kino am Potsdamer Platz gibt es ja leider nicht mehr. Die Dinosauriergeschichte ist aber auch 2022 noch nicht auserzählt. Jedenfalls denken das die Filmemacher.
Das Franchise generiert halt immer noch eine Menge Einnahmen. Der neue Film soll aber in der Tat ziemlich gräuslich sein.
Untiere sind in Märchen, Musical und Film immer schon sehr beliebt gewesen. Bei mir nicht.
3-D braucht doch sowieso niemand…
Das hat man von Autos erst auch gesagt. Bald wieder?
Berlin ist tatsächlich immer wenig vermüllter und beschmierter als andere Städte. Warum eigentlich?
Ach das ist aber doch auch nur ein Klischee. Selbst Paris ist wahnsinnig dreckig. Nur eben grundsätzlich hübscher anzusehen.
Es gibt ja auch sehr eindrucksvolle Graffities. Aber gegen diese sinnlosen Schmierereien an frisch gestrichenen Wänden würde ich ganz gezielt vorgehen.(Hände abhacken vielleicht erst im Wiederholungsfall.)
Oh der Großstadtsommer … so richtig fühle ich ihn noch nicht. Mich zieht es eher irgendwo ans Meer.
Mir ist bei permanent 33° Sommer genug. Ein bisschen Meer wäre natürlich als Anblick eine zusätzliche Bereicherung. Das Etsch-Wasser ist den Forellen schon zu warm.
Gerade in der Stadt braucht man doch auch gar keine 40° haben. Ich bin völlig zufrieden mit ein bisschen Sonnenschein und einer kleinen Brise dazu.
Man kann sich das Wetter nicht aussuchen. Man kann nur entscheiden, wo man gerne sein möchte.
Wo man gern sein möchte, lässt sich schnell klären, ob und wie man dort hinkommt schon weniger. Geld, Beruf, Bindungen spielen eine Rolle.
Was man wohl 2022 als Traditionswähler bezeichnen würde? Ist man unterhalb von 30% noch eine Volkspartei? Und gehören die Grünen nun zu diesem Kreis?
Mich interessiert vor allem wie sehr sich die Grünen zum Ende der Legislaturperiode verändert haben werden. Regieren ist eben doch etwas anderes als Opposition.
Und Regieren mit Aussicht auf einen weltweiten Konjunkturaufschwung ist etwas anderes als mit Aussicht auf einen dritten Weltkrieg.