Giuseppe ist ein viel besserer Mensch, als ich es bin (moralisch gesehen), aber sein Orientierungssinn ist vielleicht etwas weniger ausgeprägt als meiner. Wir fuhren ja nun ab Trient durch seine Westentasche und deshalb erst kurz vor Venedig in die Irre. Ich hielt ihn natürlich für einen ausgekochten Abkürzer, so dass ich bewundernd sagte: „Das Schild nach Venedig wies da lang!“ Ich sagte das in Italienisch, was vielleicht blöd war, denn es hatte zur Folge, dass er mich gut genug verstand, um in Verwirrung zu geraten. Eigentlich liebe ich es ja, Italienisch zu sprechen: Es gelingt mir da immer, mich so wunderbar unpräzise auszudrücken, wie ich es im Deutschen nie fertigbringe. Das macht mich bei Auskünften und Diskussionen ein bisschen netter, aber es hilft natürlich weit weniger bei Wegweisern, deren gnadenlose Rechthaberei meiner Anwendung des Deutschen ziemlich nahekommt. Nicht umsonst ist der Wegweiser das Hauptsymbol meines (wieder mal neu) entstehenden 78er-Films; das Buch ‚Weg ohne Weiser‘ war eine von mir geliebte Jugendlektüre, und – wie in jedem Zusammenhang – muss Schuberts ‚Winterreise‘ erwähnt werden, mit deren Lied ‚Der Wegweiser‘ der Film enden soll. Der Wanderer – mein stetes Leitmotiv.

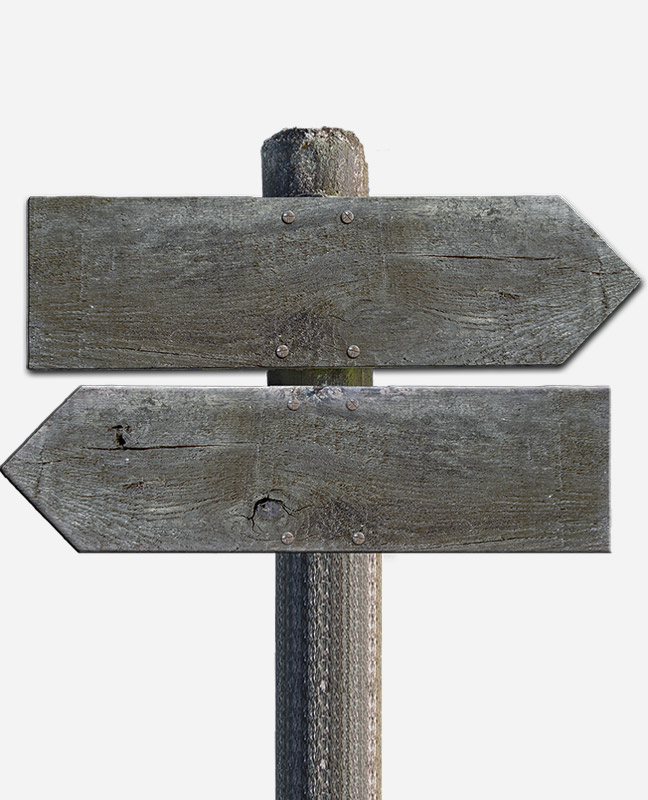

Foto (li.): Pixabay | Bild (re., Wanderer bei der Rast vor München – Carl von Häberlin, 1859): Wikimedia Commons/gemeinfrei
Jedenfalls fuhren wir kreuz und quer durch Mestre, und Giuseppe machte dieses entschlossen verunsicherte Gesicht, das man aufsetzt, wenn man sich nicht anmerken lassen mag, dass man keine Ahnung hat. Aber: Alle Wege führen nicht nur nach Rom (Gott behüte!) – auch den Venedig-Schildern entgeht man auf Dauer nicht so leicht, und so schafften wir es doch bis zu der Brücke, die das Wunder Venedig mit dem scheußlichen Festland Mestre verbindet und über die nun weder meine Mutter noch ich zu Fuß mit Gepäck in der Hand auf die Lagunenstadt zuschreiten mussten, weil Giuseppes Auto ja TÜV-geprüft ist.

Am Ende der Brücke, die 1846 als Eisenbahnbrücke noch unter dem österreichischen Kaiser und 1932 unter Mussolini als Kraftfahrzeugbrücke errichtet worden war (Geschichte des verschwindenden Wissens), wurden wir Leid-geprüft: Wer mit dem Auto auf die Fähre wollte, musste nach rechts (kennen wir), wer in einen der Parkbunker wollte, musste geradeaus (kennen wir auch), dann gab es noch eine Trasse für Busse und Taxen, die führte direkt zu den fetten Schiffen für ganz, ganz viele Menschen mit allenfalls ein, zwei Tragetüten in der Hand, aber für Privatwagen war diese Abweichung von der Norm verboten und auch sowieso ausweglos für uns, weil wir keine Einkaufstüten hatten, sondern viel, viel mehr. Und dann gab es da noch diese scharfe Linkskurve, die schnurstracks zurückführte nach Mestre.

Foto: Wikimedia Commons/gemeinfrei
Nun hat ja der prominente französische Maler Fernand Léger postuliert, die strenge Schönheit Mestres entschädige für den furchtbaren Schnörkelkitsch von Venedig, aber erstens waren im frühen zwanzigsten Jahrhundert die Fabriksilhouetten als Vorboten des Bauhauses noch gefragter als heute, und zweitens haut man ja inzwischen auch nicht mehr mit ästhetischer Begeisterung den Stuck von den Jugendstilfassaden. Man darf wieder reimen, Harmonien komponieren, Geschichten erzählen und alles das tun, was in meiner Jugend so streng verboten war, dass ich (damals) frommer Schöpfer aus der Kunst in die Industrie geflüchtet bin. Allerdings nicht nach Mestre.

Giuseppe – ‚parkte‘ wäre das verkehrte Wort –, er fuhr an einem Kantstein der Verkehrsinsel auf der Piazzale Roma einfach nicht weiter, so als sei ihm der Sprit ausgegangen, ich sprang behände wie ein von Jägern hysterisch gemachtes Reh aus meinem Taschendickicht hervor, ließ mich durch den Schock von zwanzig Grad im klimatisierten Auto und vierzig Grad in der Wetterküche nicht beirren und keuchte auf die Anlegestelle ‚Piazzale Roma‘ zu. Dort schaukelten all die vielen Schiffe auf dem Wasser und noch viel mehr berucksackte Touristen an Land, aber Taxenboote sah ich keine. Ich rannte weiter, hätte irgendjemand mir Beachtung geschenkt, so hätte er vermutet, ich sei von der aufgebrachten Menge in den Kanal geschubst worden und eile nun klitschnass zum Krankenhaus, um mich gegen Lynchpocken impfen zu lassen. So fand ich tatsächlich die Anlegestelle für Taxen und sprach jemanden an, der zwar nicht kompetent, aber zuständig aussah.

„Wo könnten wir denn hier den Wagen parken?“ Ich sah ja selbst, dass diese Möglichkeit nicht vorgesehen war.
––„Im Parkhaus“, antwortete er mir denn auch völlig unzweckdienlich.
––In meinem bewährten Italienisch erzählte ich ihm, dass wir nicht mit unserem eigenen, sondern mit Giuseppes (dessen Namen ich verschwieg) Auto hier seien. Daraufhin gab er mir wortlos zwei Informationen: Er zuckte mit den Achseln, und er wies durch eine knappe Bewegung des Genicks mit dem Kopf nach vorn. Dort befand sich eine Art Schacht zwischen zwei Häusern, die Leger sicher gefallen hätten. Dieser Schacht war so breit, dass es denkbar schien, dass Irene, Giuseppe und ich ihn nacheinander passieren könnten, wenn wir die Gepäckstücke wie einen Bauch- und einen Rücken-Laden vor und hinter den Leib gepresst hielten.

Foto: Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz)/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Ich rannte also durch die außerordentlich hohle Gasse auf die Straße nach Mestre. Fünfzig Meter vor diesem Schlitz wartete Giuseppes Wagen in halb besoffener Schieflage, die es weder Fußgängern auf dem Gehweg noch Autofahrern auf der Fahrbahn erlaubte, ihr Ziel weiter zu verfolgen. Das windmühlenhafte Rühren meiner als lang geltenden Arme brachte nichts, weil Giuseppe konzentriert in die Richtung starrte, in die ich verschwunden war. Da stand ich ja nun nicht mehr. Ich musste also gegen den Strom auf seinen Wagen zulaufen, einsteigen und ihn drängen, vor der unscheinbaren Lücke zwischen den beiden Mestre-Häusern zu – also gut – ‚parken‘.

Foto: Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz)/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Dann nahm er den einen Koffer und eine überdimensionierte Reisetasche, ich den zweiten Koffer und eine Reisetasche, etwas größer als der Koffer, Irene ihren Kosmetikschrank, ihre üppige Handtasche und ihren Mut zusammen, und dann quetschten wir uns durch den Spalt zu dem Mann, der mir geraten hatte, ein Parkhaus aufzusuchen. Er erkannte immerhin unsere Not und wies jemanden an, uns sein Wassertaxi besteigen zu lassen und uns dabei sogar behilflich zu sein, unsere wuchtigen Gepäckstücke und unsere mageren Körper über den lichtflirrenden Abstand hinweg auf sein schlingerndes Boot zu bugsieren. Ich brüllte „Villa Mabapa!“ gegen seinen wütenden Motor an, er nickte wissend und legte los, und während Irene zwischen Stehen und Sitzen schwankend stammelte: „Ich habe etwas vergessen, ich weiß, dass ich etwas vergessen habe“, winkte ich dem katholisch gläubigen Giuseppe dankbar hinterher, bevor alles, was nicht Venedig war, hinter der ersten Biegung verschwand.

Foto: Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz)/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Nun also wieder Palazzi und Kanäle: eine Welt wie nirgends sonst, unüberschaubar klein und offensichtlich großartig. Wie üblich war erst – vor dreihundert Jahren – mit dem Welken der Macht die Hingabe an die Kultur aufgeblüht: Casanova, Canaletto und Vivaldi eben. Aber erst die Zergliederung und Zersetzung der anderen Städte durch Autos und Busse brachte Venedig die einmalige Stellung zurück, die es zur Hoch-Zeit der Dogen gehabt hatte. Es glitt alles so dahin, die Jahrhunderte gaukelten vorbei, die Männer am Ufer trugen kurze Hosen, und ich sann darüber nach, wie wir wohl unser Gepäck, rein physikalisch, aus dem inzwischen bereits die Lagune durchknatternden Taxi in diese zwei Zimmer transferiert bekommen sollten, wissend, dass der Sinn der beiden uns zugedachten Räume darin bestand, unter sich auszumachen, welcher von beiden eine Chance bot, Irene zu gefallen.

Foto: Privatarchiv H. R.
Es täuscht: Ich sperre mich keineswegs gegen Neuerrungenschaften, bloß weil ich, wenn ich meine Mahlzeit beendet habe, gestärkten Damastmundtüchern gegenüber Papierservietten den Vorzug gebe. Im Gegenteil: Ich griff zu meinem modischen Handy und teilte der Rezeption bei ‚Mabapa‘ mit, dass wir schon an San Giorgio vorbei seien. Der Empfangschef nahm wohl an, wir kämen geschwommen, jedenfalls trafen wir am Anlegesteg von ‚Mabapa‘ ein, ohne dass die kochende Siesta bereits durch den Karren eines Gepäckträgers gestört worden war.

Also wählte ich die gespeicherte Nummer noch einmal und schrie (wegen des Motors): „Eccoci!“ (Da sind wir!), wobei ich mein Brüllen versuchte, ungeduldig-herrisch und nicht verzweifelt klingen zu lassen. Es kam dann auch wirklich jemand sehr Soigniertes, dem ich mich nie getraut hätte, ein Trinkgeld zu geben, wenn ich ihm in anderem Zusammenhang begegnet wäre. Während der Herr also zusammen mit dem Taximatrosen dafür sorgte, dass nichts ins Wasser fiel, schob ich die etwas ladymacbethhaft agierende Irene in Richtung Hoteleingang und fand es dabei beruhigend, dass sie nicht das keinesfalls vorhandene Blut an ihren Händen beklagte, sondern den Verlust ihrer vollständig vorhandenen Gepäckstücke. Eigentlich war ich damit im Unrecht, denn besser, man glaubt sich nur dreckig, als wenn wirklich was fehlt.

Foto: Wikimedia Commons/gemeinfrei
Dieser zu jenem Zeitpunkt von mir nicht gedachte Gedanke brachte mich, als die Zimmer mit Balkon und mit Bad und in Ordnung waren, darauf, was wirklich fehlte, dass nämlich von den vielen Brücken Venedigs die wichtigste in meinem Mund wackelte. Dahin hatte ich sie nach dem gestrigen Abendessen wieder zurückgestopft. Kronen, Zahnkronen meine ich, habe ich schon in Briefumschlägen und zwischen Kleingeld im Portemonnaie aufbewahrt, aber bei einer solch langgestreckten Brücke dachte ich: „Wo wäre sie wohl sicherer aufgehoben als dort, wo sie hingehört – solange ich keine Mahlzeit zu mir nehme.“ Genau das allerdings stand ja bevor. Silke, die morgen einschweben sollte, hatte sich aus Anlass ihres Geburtstages ‚Da Fiore‘ gewünscht. Über Geschmack lässt sich trefflich streiten, über Preise weniger, jedenfalls ist es Venedigs teuerste ‚Trattoria‘, so dass ich den Tisch schon zwei Wochen vorher in Meran hatte bestellen müssen, um noch einen Platz zu ergattern. „Am Fenster bitte!“, setzte ich noch eins drauf. Die Taxifahrt zurück zu ‚Mabapa‘ musste den Menüpreisen zusätzlich hinzugerechnet werden, denn es war klar, dass man Irene nach der weingespickten Mahlzeit den komplizierten Weg zur Anlegestelle plus Fahrt über die Lagune nicht würde zumuten können, und die Fahrt vom Kanalausgang der Restaurants durch das nächtliche Venedig und zurück zum Lido war ohnehin ein Dessert, das jede Panna cotta übertraf.

Foto: Matthias Ripp/Pxhere
Kurz erwähnen möchte ich aber dennoch, was es mit der Panna cotta ursprünglich auf sich hatte: ‚Die Süßspeise ist seit dem 10. Jahrhundert in Piemont gebräuchlich, wo sie angeblich von einer Dame ungarischer Herkunft entwickelt wurde‘, glaubt Wikipedia. ‚Traditionell wurde als Bindemittel Hausenblase verwendet. […]‘1 Dafür wird die Schwimmblase des Hausen, einer Art Stör, ‚ausgenommen, in heißes Wasser eingelegt, von Adern und den sie umgebenden Muskeln befreit und […] getrocknet.‘ 2 Solches Zeug hätte ich nie im Nachtisch vermutet, es zeigt aber, dass es noch weit mehr Blasen gibt, als ich mir beim Betiteln dieses Werkes vor einem halben Jahr hatte träumen lassen.

Foto: Roberta F./Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 | Titelillustration mit Bildmaterial von Shutterstock: Just dance | Vic Lab
#16 – Die unendliche Schwierigkeit aufzustehen#18 – Im Wartezimmer


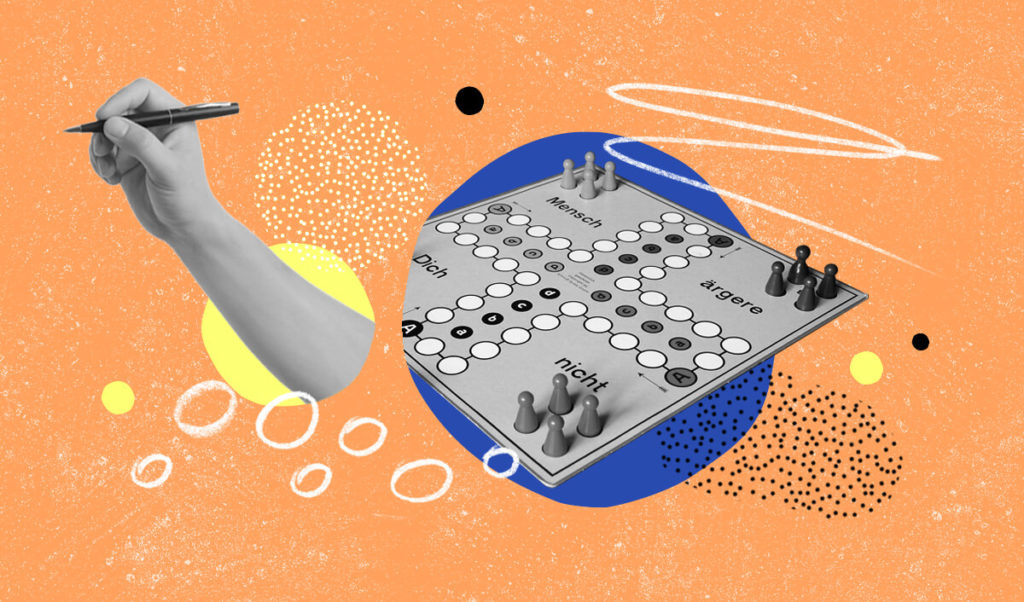
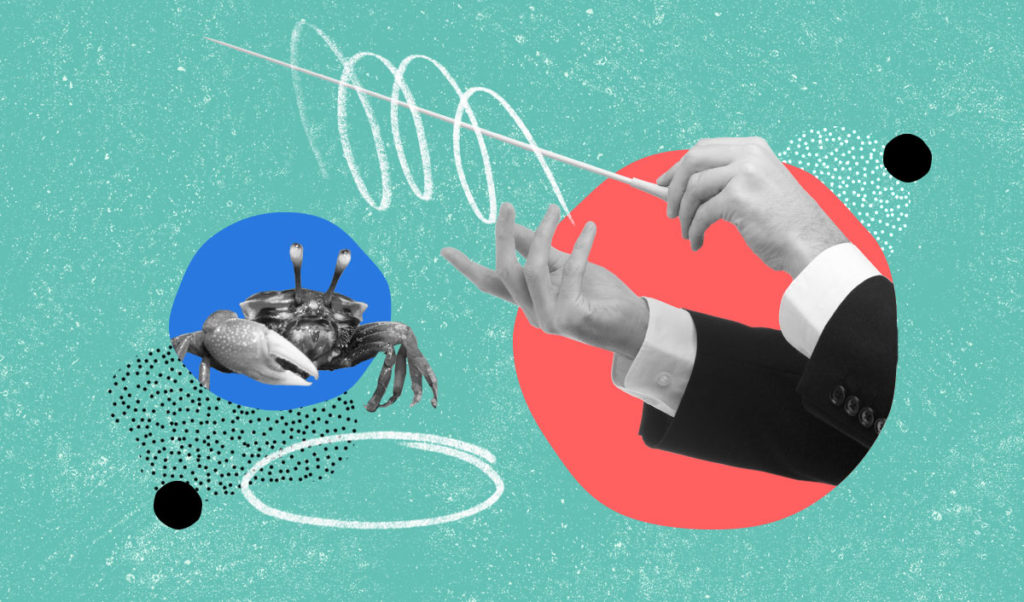








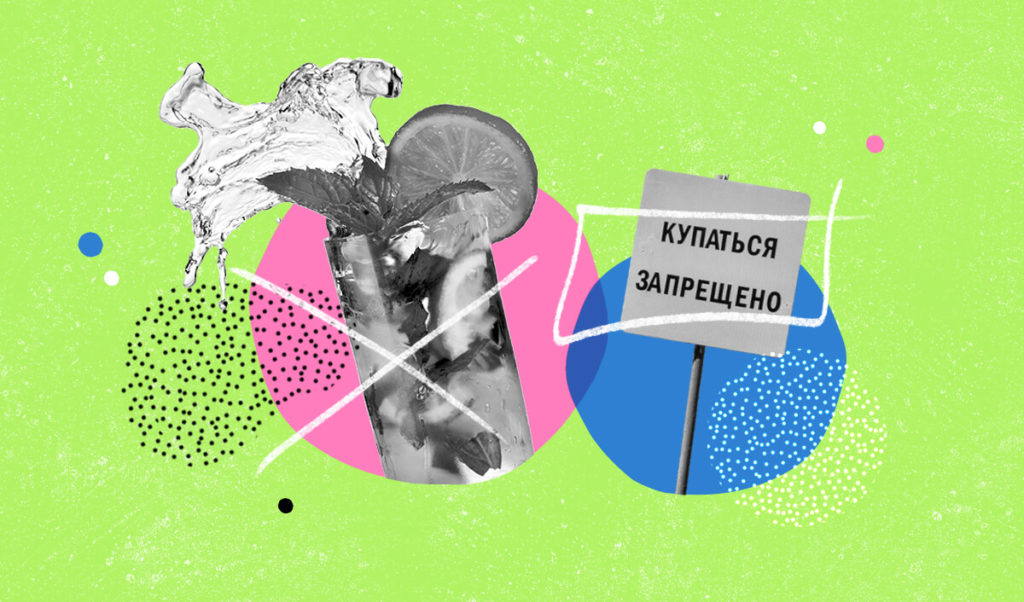

































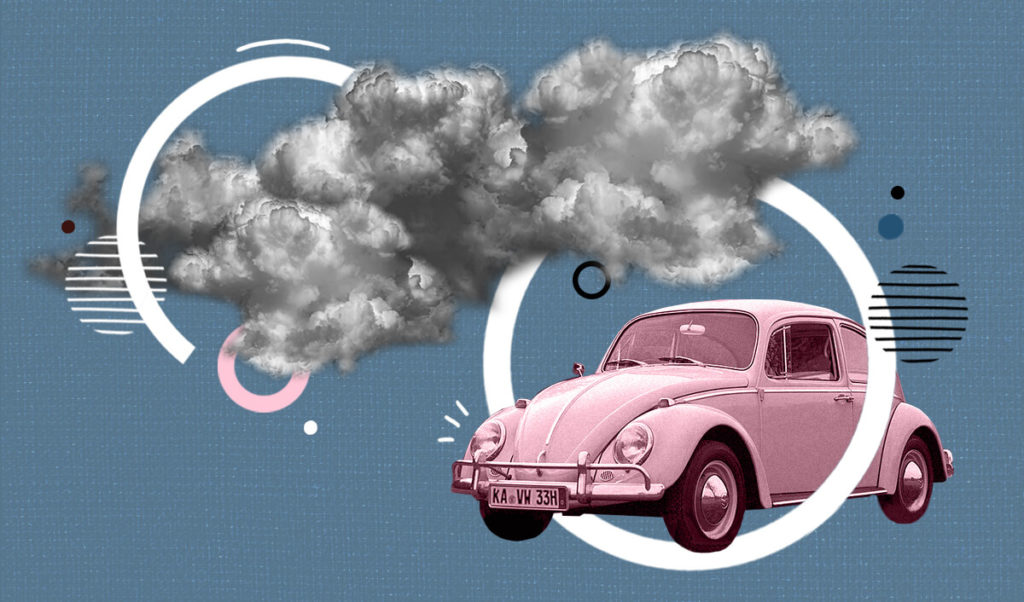
























Ich sympathisiere immer sehr mit Menschen, die einen schlechten Orientierungssinn haben. Mir geht es nämlich meistens ähnlich.
Zum Glück gibt es ja mittlerweile in so ziemlich jeder Hand ein smartes Phone. inklusive verschiedenster Orientierungshilfen und Kartenwerkzeuge.
Nun ja, Karten gab es ja schon immer und trotzdem bleibt der ein oder andere aufgeschmissen.
Manche Gläubige folgen ihrem Navi genauso stur wie andere der Bibel oder dem kommunistischen Manifest. Das kann in der Wüste enden.
Man hat schon von Autofahrern gehört, die auf Anweisung ihrer Navisoftware in einen See oder ins Meer gefahren sind. Vielleicht sind das aber auch „Urban Legends“. Ich selbst erinnere mich jedenfalls an ein, zwei brenzlige Situationen, weil mich der Bildschirm tatsächlich vom echten Geschehen abgelenkt hat.
Schlimm sind nur Menschen, die keinen Orientierungssinn haben, aber immer wissen, wo’s lang geht. Bei amerikanischen Präsidenten ist das besonders deprimierend.
Ich gebe ungeniert zu: ich musste „soigniert“ nachschlagen.
Altmodische Wörter finde ich nun mal cool.
Unbedingt. Und wenn sie dann noch französischen Ursprungs sind verwende ich sie sogar noch lieber.
Dann sollte Ihnen diese Liste gefallen: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Gallizismen
… und soigniert ist noch nicht mal dabei!
Die ungarische Herkunft zweifle ich ja ein wenig an, aber ich liebe eine gute Panna Cotta. Die beste habe ich bisher in Rom in einem kleinen traditionellen Restaurant gegessen.
Na sie kommt ja dennoch aus dem Piemont. Warum soll da nicht eine ungarische Köchin am Werk gewesen sein 😉
Was ist Venedig doch für eine seltsame Stadt, dass sie Scharen über Scharen an Touristen und Reisenden anzieht, und eigentlich überhaupt nicht für das Herumtragen und -schieben von Koffern gemacht ist.
Sie ist auf Pfählen extra so gemacht, dass fremde Leute gar nicht reinkamen. Das ist allerdings 1500 Jahre her. Damals gab es noch keine Keuzzüge, keine Kreuzfahrten und keine Drohnen.
Tja, ursprünglich wurden alle Städte möglichst so geplant, dass von aussen niemand eindringen konnte. Heute kämpft man um Besucher, selbst wenn sie die Städte langsam aber sicher zerstören.
Hahaha, vielleicht sollte ich den Trick mit der Fremdsprache auch mal ausprobieren. Damit man beim Small Talk sympathischer rüberkommt 😉
Das kann unter Umständen und je nach Grad der Fremdsprachenkenntnisse auch schnell anbiedernd, peinlich, oder unverschämt wirken. Es braucht da jedenfalls etwas Fingerspitzengefühl.
Wann nicht?
Hahahaha!
Nun ja, die Franzosen erwarten auch heute noch, dass man zumindest probiert sich in der Landessprache zu verständigen. Da mag man dann zwar ebenfalls aufgrund blamabler Kenntnisse belächelt werden, aber als anbiedernd wird man sicher nicht empfubnden.
Gute Regelung, dass man jetzt 2 + 2 zusammenzählen muss, bevor man Kommentare abschicken kann. Das schließt facebook-Besucher weitgehend aus. Sollte Venedig auch einführen.
Dabei bin ich erst durch Facebook auf den Blog aufmerksam geworden 😉
Alle schließt es ja auch nicht aus. Willkommen im kleinen Einmaleins!
Kleine Rechenaufgaben als Zugang zu Blogs, Cafés, Wahlen, ganzen Städten… da ließe sich viel mit machen.
Bei den Wahlen finde ich das am bedeutsamsten, auch wenn es in AfD-Kreisen heißt: „Dumm wählt gut!“.
Dumm wählt gut, und wenn dann noch möglichst wenig Menschen wählen gehen kommt das oft sogar noch besser an. Deswegen ist Herr Trump ja auch gegen eine Briefwahl.
Venedig bei Nacht (oder alternativ am Abend) ist einmalig. Da sind die ganzen Tagestouristen schon wieder zuhause und man hat die Stadt ein ganz klein wenig für sich alleine.
Wie stressig doch auch ein Urlaub sein kann. Und wie langweilig wenn es nicht so wäre 😉
Ich habe Langeweile ganz gern, ich nenne sie ‚Entspannung‘.
Haha, ja das stimmt. Manchmal kann man die Langeweile definitiv auch genießen.
Langeweile (zum Beispiel am Wochenende) stresst mich aber auch schnell. Wahrscheinlich ist das aber auch nur ein Zeichen, dass mein Leben grundsätzlich zu stressig abläuft.
Haha, ich mochte den Titel wirklich sehr. Gerade weil eine Ankunft durch die Kanäle Venedigs ja in der Regel eben nicht einfach „irgendwie eintreffen“ bedeutet.
Ich bin mal spät abends am Flughafen angekommen. Die Wassertaxifahrt durch das bereits leere Venedig war einmalig.
…, dass nämlich von den vielen Brücken Venedigs die wichtigste in meinem Mund wackelte.
Genial! Hat mich laut auflachen lassen!
Der Tag ist gerettet!