

Giuseppe wünscht sich Pankow, weil er Pankow früher immer in der Zeitung gelesen hat, wie Bonn oder Washington: ‚Aus Bonner Kreisen verlautet …, dagegen hat Pankow schärfsten Protest eingelegt.‘ Nachrichten-Sprache, die kein sehr ergiebiges Ausflugsziel vermuten lässt, aber wer so lange gewartet hat wie Giuseppe, dessen Wunsch soll in Erfüllung gehen, auch wenn er doof ist.
Wir fahren über Gesundbrunnen (Berliner Gassen-Jargon: die Plumpe). Die Ramlerstraße (mit einem ‚m‘!), von Roland liebevoll-spöttisch ‚Rue Ramlère‘ genannt, war bis kurz vor unserer ersten Begegnung sein muffiges Zuhause einschließlich Praxis. Wenn wir die Gegend später aufsuchten, war sie mehr und mehr heruntergekommen: düster, grau, trostlos und umklammert von einer Mauerecke. Jetzt ist alles heller, die Fassaden sind gestrichen, die Fensterrahmen erneuert, die Mauer weg – alles ist besser, bis auf meine Stimmung.
Und dann ging es mit uns durch: Der Straßenverlauf der Bernauer Straße war früher die Grenze. Bis die Fenster der Häuser am Prenzlauer Berg zugemauert wurden, sprangen noch wochenlang zu allem entschlossene Menschen in die schäbige Freiheit des Wedding. Wie zwei Trüffelschweine im Wald schnüffelten wir der ausgelöschten Sensation hinterher. Im struppigen Rasen vor den Mietskasernen fanden wir weder Blut noch Schicksalsschweiß – nur Colablech und verwesende Tempo-Tücher. In Pankow war es nicht anders, nur geringfügig appetitlicher. Pankow und Prenzlauer Berg unterscheiden sich von Wedding und Kreuzberg nicht in der Bauweise, sondern in der Bevölkerung: Der Osten ist ‚türkenfrei‘. In der ‚Morgenpost‘ las ich, dass Ausländer die Ostbezirke aus Furcht vor Übergriffen mieden. Interviewte berichteten, dass sie nicht mal mit der U-Bahn in den unheimlichen Osten führen. Das marxistische Ideal der Völkerfreundschaft gehört zu den Zielen, die während der Zeit, die dem Sozialismus von der Geschichte eingeräumt wurde, unerreicht blieben.
Wir sahen uns das Rathaus von Pankow an, mutmaßlich der Sitz der drei hohen Genossen – bevor die Regierung der sowjetischen Besatzungszone ins Rote Rathaus zog –, die nun keine Straßen und Sportplätze mehr zu ihrem Gedenken haben: Ulbricht, Pieck und Grotewohl. Die Berliner Bezirksrathäuser scheinen alle zur selben Zeit in rotem Klinker erbaut worden zu sein. Von Köpenick bis Schmargendorf verschwindet man am besten gleich im Ratsweinkeller. Inzwischen gibt es auch einen Schankaustausch: Radeberger im Westen und Warsteiner im Osten. Ich erinnere mich noch gut an das frühere Radeberger: Halb-Liter-Flaschen, abgeschrammt, mit verblichenem Etikett. Jetzt kommt es in schlanken Drittel-Liter-Flaschen dahergetänzelt, mit Goldkragen und dem Spruch: ‚Es ist an der Zeit, ein Bier zu feiern, wie es so gebraut in Deutschland nirgendwo ein zweites gibt.‘
Die ehemaligen Hauptkonsumenten lungern im Nirgendwo ihrer Hoyerswerdaer Plattensiedlung und sind auf Dose umgestiegen: Mit der kleinen Flasche kam der große Preis. Eines der wenigen Ost-Produkte, das sich im Westen durchgesetzt hat und im Osten verlor. Die Radeberger Gruppe KG hat übrigens ihren Sitz in Frankfurt am Main. Sie ist die größte Brauereigruppe in Deutschland, Berliner Kindl und Schultheiss gehören ihr auch. Desillusionierend!
Nachdem uns Pankow im Regen genügend gelangweilt hatte, fuhren wir ohne Rast in unsere Tiefgarage zurück und mit dem Fahrstuhl dem Bett entgegen.
Dorothee hatte uns für den Abend ins Restaurant eingeladen, zu zwanzig Uhr. Vorher sollten wir einen Sherry bei ihr trinken. Die vertraute Strecke Friedrichstraße bis Savignyplatz. Weil ich nicht wieder hetzen wollte, waren wir rechtzeitig aufgebrochen, mit dem Erfolg, dass wir mit Schleichgang und Blumenkauf um sieben Uhr vor ihrem Tor standen. Es regnete. Ich klingelte, Dorothee empfing uns etwas verwirrt im Bademantel. Zu früh kommen ist mindestens so ungezogen wie zu spät kommen. Aber ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass Dorothee irgendwann mal nicht fertig ist. So trank ich eben zwei Sherry, während sie mich im Bad nicht beobachtete.
Dorothee führte uns über den Kurfürstendamm hinweg zum Ludwigkirchplatz in ein italienisches Lokal. Das ist wohl das Schicksal aller Italiener in der Fremde.
„Is’ nett hier, nicht?“, bestätigte Dorothee. Dann ging die Unterhaltung in Italienisch weiter.
Aus gegebenem Anlass hielt Giuseppe Dorothee einen inbrünstigen Vortrag darüber, warum ich sei, wie ich bin. „Es ist an der Zeit …“ Immer wenn sie etwas einwenden wollte, wurde sie niedergedonnert mit „Ma capicci, Dorothee!“
Ich saß stumm daneben und war so geschmeichelt wie immer, wenn es um mich geht, egal ob gut oder schlecht. Die Begründung, warum ich so viel tränke, illustrierte ich mit hemmungslosem Weinkonsum. Dorothee war auch ganz benommen. Meist ist es so: Bei den ersten beiden Gängen würge ich noch, aber dann, zwanglos und entspannt, kann ich unbegrenzte Mengen von Tiramisu und Pannacotta vertilgen. Giuseppe, der ja gerade eine Demonstration seiner Kenntnisse über mich vorgeführt hatte, weiß auch das: Von meinem Dolce kriegt er nie was ab. „Wenn das Wetter besser gewesen wäre, hätten wir draußen gesessen“, sagte Dorothee, nachdem ich heimlich gezahlt hatte, „nächstes Mal!“ Sie ist auch süß.

Titelgrafik mit Material von: Dirk Ingo Franke/Wikimedia Commons, CC BY 3.0 (Mauergedenkstätte, Bernauer Straße) und Shutterstock: ebenart (Rathaus Berlin-Pankow), Alex Staroseltsev (Taschentuch), Digital signal (Straßenschild)

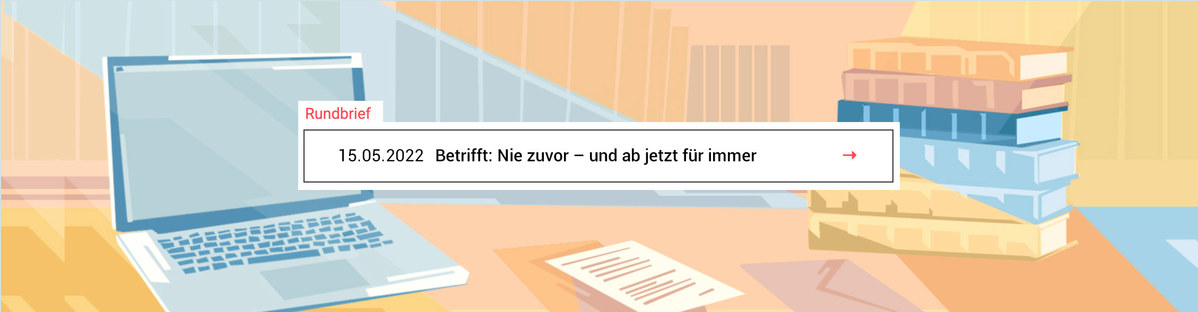







































































Ich bin glaube ich so ziemlich der einzige, der Tiramisu furchtbar langweilig und schwer findet.
Es kommt auf die Menge von Amaretto und Grappa an. Ansonsten reicht als Nachtisch auch ein Stück Bel Paesa (schmeckt herrlich nach: Nichts).
Man könnte jetzt sagen, vielleicht haben Sie noch nie ein richtig gutes Stück Tiramisu probiert. Aber meistens sind solche Sprüche albern und die Geschmäcker einfach zu verschieden.
Bacala (Stockfisch) habe ich drei Chancen gegeben. Keine hat er genutzt. Tiramisu kann langweilig schmecken. Bacala schmeckt gemein.
Mir geht es mit Austern so. Für die meisten ist es eine Delikatesse, mir geben sie geschmacklich einfach nichts.
Alles, was man nicht genießen kann, ist schade: Fußball, Gruppensex, Punk. Dafür geht einem vielleicht das Herz auf beim Duft von Maiglöcken, den andere gar nicht bemerken. Schon meine ersten Austern mochte ich: der Kuss des Meeres. Wer allerdings eine schlechte wegschluckt, ist schlechter dran, als wenn der eigene Fußballverein verliert oder man beim Gruppensex das falsche Geschlecht erwischt hat.
Pankow langweilt mich auch immer. Egal ob bei Regen oder Sonnenschein.
Pankow erhebt allerdings auch nicht den Anspruch, besichtigt werden zu wollen.
Man kann durch den Bürgerpark spazieren. Aber Pankow ist sonst ja auch eher Wohngegend. Die Touristen-Hotspots findet man woanders. Die Pankower freut das bestimmt.
Dass türkischstämmige Berliner nicht in den Osten fahren würden, höre ich zum ersten Mal. Wahrscheinlich ist das genauso eine übertriebene Meldung wie die Berichte über den unglaublich gefährlichen und unbedingt zu meidenden Kotti.
Das ist über zwanzig Jahre her. Heute mag das anders sein. Früher in der DDR bedeutete ‚Völkerfreundschaft‘ jedenfalls das Gegenteil von ‚Weltoffenheit‘.
Oh, das Schicksal der Italiener in der Fremde! Jedes Mal wenn ich nach Italien reise, bin ich wieder beeindruckt wie gut – und wie viel besser – das Essen dort ist.
Besser als das italienische Essen sonst wo, oder einfach grundlegend besser?
In erstklassigen Lokalen ist italienisches Essen nicht schlechter als im Land selbst. In von ausgewanderte Kroaten geführten Pizzerien wird die Pizza Hawaii bisweilen mit Dosenananas gereicht.
Was mich gewundert hat als ich das letzte Mal in Italien war, war dass die Jugendlichen dort tatsächlich Pizza mit Pommes bestellen. Ich hätte erwartet, dass so etwas verpönt ist.
Und dann behaupten die Alten, die Jungen hätten keine Kultur. Ich bin alt. Mir kommt Pizza mit Fritten vor wie Spaghetti mit Milchreis und Kartoffelbrei. Aber: Stil macht nicht satt.
Ich finde es gehört immer auch ein wenig dazu, dass die Jugend ihr eigenes Ding macht. Alles andere käme mir zu konservativ vor. Also in dem Sinne, dass sich die Gesellschaft nicht vorwärtsbewegt.
Pommes auf Pizza sind ein gesellschaftlicher Schritt nach Vorne?
Sein ‚eigenes Ding‘ zu machen, ist schon seit einiger Zeit eine recht etablierte, also konservative Art, sein Leben zu fristen.
Ah Moment … und warum sind Sie nun so wie Sie sind?
Na, die Frage lässt sich doch zumindest teilweise beantworten, wenn man sich durch die Tiefen des Lesesaals arbeitet…
Sonst bleibt es Giuseppes und Dorothees Geheimnis.
Ich habe immer Angst, dass ich zu spät komme und ende dann meistens aber so, dass ich noch zehn Minuten vor der Wohnung des Gastgebers auf und ab laufe um nicht überpünktlich zu klingeln. Eine ziemlich blöde Angewohnheit, aber ich hab es mir noch nicht abtrainieren können.
Es gibt ja schlimmere Angewohnheiten. Ich ärgere mich jedes Mal wenn jemand regelmäßig eine halbe Stunde zu spät kommt.
Wenn es regelmäßig ist, kann man damit ja umgehen. Man variiert die Termine entsprechend. Im Freundeskreis sind die Forschen und die Bummler meistens bekannt.
Manchmal ist das einfacher gesagt als getan. Die eigenen Gewohnheiten ändert man ja trotzdem nur schwer.
Man muss ja auch im Auge behalten wer einlädt. Die einen sind eher eingeschnappt wenn man spät ist, die anderen finden es unmöglich wenn man zu früh ist.
Lange Warterei macht ungeduldig, aber wenn es klingelt und man sitzt noch in der Badewanne: das ist schlimmer.
Wenn jemand deutlich zu früh klingelt, muss man ja nicht aufmachen 😉
Diesen ehemaligen Grenzstreifen an der Bernauer Straße finde ich sehr beeindruckend gestaltet. Obwohl ja kaum noch Mauerreste stehen, spürt man doch was diese Trennung für die Menschen einmal bedeutet haben muss.
Wenn ich in West-Berlin war, habe ich die Mauer meistens gar nicht gesehen. Ich war ja auch nie in Britz oder in Frohnau, obwohl beides im Westen liegt. Erst ab 1990 habe ich deutlicher gespürt, wie begrenzt West-Berlin gewesen war.
Mir ist es immer unangenehm, wenn über mich gesprochen wird. Wenn es um Komplimente geht, fast noch mehr als wenn es Kritik gibt.
Es macht natürlich noch einen Unterschied ob zu einem oder über einen gesprochen wird, und ob man überhaupt selbst dabei ist.
Wenn über einen gesprochen wird und man sitzt daneben, geht es einem wie mit schwarzen Oliven: eigentlich schmecken sie nicht, aber man nimmt doch noch eine.
Hahaha, so geht es mir grundsätzlich mit Oliven. Genießen tut man sie nicht, aber sie sind eben da. Bei Komplimenten sagt man im Zweifelsfall schnell danke und lenkt auf ein anderes Thema über.