Harry wollte am Konzerttag schon frühzeitig in der Philharmonie sein, um hinter der Bühne noch stören zu können. Der Dunstkreis von Künstlern tut seinem Atem schon seit jeher gut. Ich kriege da eher Erstickungsanfälle, und Pali, der ungern eine Gehässigkeit ausließ, behauptete, dies sei darauf zurückzuführen, dass ich lieber selber Star sei, als einen um mich zu haben. Trotzdem traf Harry erst kurz nach mir am verabredeten Treffpunkt vor den Kassen ein. Er kam mit einem Japaner, der auch für den Bernstein-Clan arbeitet und der Harry offenbar zu spät vom Hotel abgeholt hatte. „But don’t speek about it“, raunte Harry mir zu, und obwohl ich mich nicht als extrem schweigsam einstufe, hätte ich auch gar nicht gewusst, wie ich das zum Gegenstand einer Unterhaltung hätte machen sollen.
Dann war da noch Uwe Dierks, er leitet gemeinsam mit Tommy Grube, der aber schneiden musste, ‚Boomtown‘, ein Studio, in dem alles zu Videos verarbeitet wird, wofür Kunden bezahlen. Beide sind auch bei der Deutschen Grammophon gut im Geschäft und große Bernstein-Fans, aber sehr sympathisch. Der Fünfte, der sich zu uns gesellte, war ein sehr gut aussehender junger Mann; er siezte mich artig und erkundigte sich höflich nach meiner Mutter. Wie immer war ich froh, vorab schon mal mit Dorothee gesprochen zu haben, die übrigens gerade in Begleitung eines kulturell fraglos bedeutsamen Ehepaares hoheitsvoll grüßend vorbeigeschritten war. Ich bin es seit Lehrlingstagen gewohnt, dass mich Dorothee nur flüchtig kennt, wenn sie sich im Kreise erlauchter Persönlichkeiten befindet. Dieser adrette junge Mann musste Sebastian sein, und offenbar hatte er auf Harrys Silvester-Party an unserem Tisch gesessen.
Die letzten Zweifel waren beseitigt, als Harry ihm seinen Mantel übergab und Sebastian, den ich ja, weil er mich so gut kannte, nicht nach seinem Namen fragen konnte, mit mir zur Garderobe ging. Vorher hatte Harry uns alle mit Eintrittskarten versorgt; wir nahmen sie entgegen wie folgsame Schüler ihre Belobigungen und strebten in unterschiedliche Richtungen auseinander.
Die eine Garderobiere sagte, sie hätte keine Bügel mehr, die nächste hatte nicht mal mehr Haken, und bei der dritten mussten wir anstehen. Jedenfalls hatte es schon dreimal geklingelt, als wir hurtig die Stufen empor- und dann wieder runterliefen, weil wir in Block C nicht rechts, sondern links Platz nehmen sollten.
Wir saßen direkt nebeneinander, und daneben saß Harry, und in der Reihe vor uns saß Uwe, mit dem ich mich duze. Der Japaner saß irgendwo – das hatte er nun davon, dass er zu spät gekommen war. Harry hatte sich den Platz direkt am äußeren Gang gesichert, so konnte er sofort hinter die Bühne, falls erforderlich; allerdings saßen wir recht weit oben, sodass jemand aus der Mitte der ersten Reihe ihn hätte übervorteilen können.
Das Programm wies auf eine Pause vor dem Credo hin. Mit Erleichterung stellte ich fest, dass diese Pause nur auf dem Papier stand, denn auf diese Weise war das Ende der Veranstaltung zügiger zu erreichen. Und wer will schon mitten in einer Messe Wein trinken? Außer dem Priester, der dafür nicht anzustehen braucht.
Sicher, ich schwelgte, wenn auch mit Unbehagen, in Erinnerungen, weil ich diese misslungene Messe schon mit Roland in Israel und mit Irene in London erlebt hatte. Die Schemen der Bernstein-Zeit mit ihren Triumphen und Abenteuern gaukelten um mich her. Selbst das allsonntägliche Abfeiern der Liturgie klang aus meiner vergilbten Jugend herüber. Trotzdem konnte ich weder dem Text, der die katholische Messe mal verehrt und mal verhöhnt, noch der Komposition etwas abgewinnen, das mein Urteil revidiert hätte. Im Gegenteil: Die konzertante Aufführung, die vielen Instrumente, die Chöre, die Lautsprecher und die Klangeffekte überdeckten nicht die Schwächen des Werkes, sondern legten sie bloß. Es war traurig. Immer schon waren die Meinungen widersprüchlich gewesen. Der Kritiker John Ardoin schrieb: „Die großartigste Musik, die Bernstein je geschrieben hat.“ Harold Schonberg, der Kritikerpapst der „New York Times“, fand dagegen: „Eine Verbindung aus Oberflächlichkeit und Überzogenheit.“1
In London hatten meine Mutter und ich ‚Mass‘ szenisch erlebt. Die Bewegung hatte dem Stück gutgetan. Das Getobe und das Innehalten fehlten mir hier. Jerry Hadley sang den Zelebranten: so schlecht, dass selbst ich es merkte. Kein Ton saß richtig. Harry sagte hinterher, Jerry sei erkältet. Aber so erkältet kann man gar nicht sein oder man bleibt im Bett. Natürlich zog es Harry dennoch magisch hinter die Bühne.
Sebastian und ich gingen inzwischen die Mäntel holen. Da er mich ‚Herr Rinke‘ nannte, hätte ich ihn mit seinem mir von Dorothee verschwiegenen Nachnamen ansprechen müssen. Oder ich wäre plump geworden und hätte ihn ‚Sebastian‘ genannt, aber hundertprozentig sicher war ich mir ja auch seines Vornamens nicht. Tapferere fragen einfach, aber die sagen auch, dass sie keine Lust auf Rihm haben, sogar ohne Cousinen-Gans. Es half alles nichts, wir mussten mit Harrys Mantel hinter die Bühne, und den verschwiegenen Gang dorthin fand ich, jahrzehntelang geschult, weitaus flinker als Block C.
Es konnte ja nicht anders sein, natürlich sprach Harry mit Jerry Hadley. Mit dem hatte ich während meiner und seiner Glanzzeit ‚La Bohème‘ und ‚Candide‘ aufgenommen und ich hatte ihn als Ehrengast auf einer meiner Marketing-Veranstaltungen willkommen geheißen. Obwohl ich immer als Hanno durch die Welt gereist war, würde er vermutlich selbst jetzt noch meinen Nachnamen besser kennen als ich Sebastians Vornamen. Es galt also, gar nicht erst in sein Blickfeld zu geraten; denn was sollte ich zu ihm sagen? ‚Really brave, that you did it anyway!‘? –‚This was great‘, ging nicht. Ich weiß noch, wie Dorothee Bernstein einmal backstage gratulierte und er sie anbrüllte: ‚Don’t you have ears? This was the worst performance I ever gave in all my life!‘ – ‚I understand you have a bad cold‘, fand ich auch unangebracht, obwohl ich durch meinen früheren Beruf trainiert darin bin, meiner Stimme auf Anhieb tiefes Mitgefühl beizumengen. Außerdem redete er mit Harry so ausladend und draufgängerisch, wie man sich das von einem Tenor, besonders im ersten Akt, vorstellt. Es schien dabei, als sei er weder erkältet noch für irgendjemanden außer für Harry von Interesse. Erst als sie sich verabschiedet hatten, näherten wir uns Harry. Ich hatte es für taktisch notwendig gehalten, Uwe, der Uwe hieß und Sebastian, der wahrscheinlich Sebastian hieß, in meinen Seelenzustand einzuweihen, wenn auch nicht so ausführlich wie in den vergangenen drei Absätzen.
Das Schicksal handelt nach zwei ziemlich schlichten Regeln. Erstens: Wenn man jemanden gern treffen möchte, begegnet man ihm nicht. Zweitens: Wenn man jemanden nicht sehen will, läuft er einem andauernd über den Weg. So auch Jerry Hadley, der ja vielleicht besser hätte singen können, aber trotzdem denselben Ausgang wie wir benutzen musste. Mal blieb Harry auf der Treppe stehen, dann überholte er uns. Dann sprach ihn doch noch jemand an, und wir überholten ihn. Dreimal musste ich also mit abgewandtem Kopf und hochgeschlagenem Mantelkragen an ihm vorbei; es war schlimmer als das Samstagabend-Lustspiel im Mitteldeutschen Rundfunk. Doch es kam noch wüster: Als wir endlich auf dem nasskalten Platz vor der Philharmonie standen und sich das Publikum längst schon wieder in Einzelwesen aufgelöst hatte, sagte Harry: „Let’s have a beer! Where shall we go?“
Ich kann Gruppendruck nicht standhalten. Ich bilde mir gern ein, ich hätte damals keine Juden erschossen, aber sicher bin ich mir nicht, weil ich den Gruppendruck meiner schießenden Kameraden so schlecht ausgehalten hätte. Wenn ich nachts im Bett an dieser Stelle angekommen bin, fege ich meine schwermütigen Gedanken mit der Einsicht beiseite, dass ich dank meines jüdischen Blutes ja Gott sei Dank eher selber erschossen worden wäre, und dass ich doch eigentlich gar nicht so angepasst sei, sondern oft ziemlich kecke Bemerkungen mache, nach dem Genuss von Schnaps sogar sehr kecke, sodass mir Andersdenkende, ebenfalls nach dem Genuss von Schnaps, durchaus auch schon handgreiflich gekommen sind, weil nicht so sehr was, sondern wie ich es sage, einfachere Menschen dazu verleitet, mir nicht mit der Zunge, sondern mit der Faust zu antworten. Man verkehrt schließlich nicht immer nur in der Philharmonie, sondern auch an Stätten mit großer Dissonanz. Ich will mich nicht kleinmachen: Meine Sprache kann sich so gut verkleiden, dass nicht mal Jerry Hadley mich in ihr erkennen würde, und von der total supergeilen Echtzeit-Spreche bis zum Looser-Idiom, das vor jedes Substantiv ein ‚Scheiß-‘ oder ‚Fuck-‘ setzt, steht an Schlichtem wie an Perversem vieles in meiner Asservatenkammer bereit. Nur: Wenn der Lehrer eine Frage stellte und alle sich duckten, dann konnte ich diesem Druck nie standhalten, sondern habe mich lieber gemeldet und irgendetwas gesagt, als zu riskieren, dass ich aufgerufen würde und nichts zu sagen hätte. Während ich den vorigen Absatz dachte, vergingen fünf lähmende Sekunden der Stille. Dann sagte ich: „Max und Moritz.“ Der Name gefiel allen. Kennen tat es keiner. „Have you been there?“, fragte Harry. Ich dachte an Michaels schriftlichen Hinweis, dass er keinerlei Garantie übernehmen könne und sagte. „Oh yes, it’s fun.“ Zu allem Übel kam auch gerade ein Taxi, ich winkte es wie in Trance heran. Harry, Uwe und vermutlich Sebastian stiegen ohne Absprache hinten ein; ich musste nach vorn, ich war ja nun der Führer. „Kennen Sie das ‚Max und Moritz‘?“, fragte ich den Fahrer so, dass es nicht neugierig, sondern bestimmend klingen sollte.
„Nie jehört.“
„In der Oranienstraße“, sagte ich. Das hatte ich mir gemerkt, schon, weil ich es nicht mit der Oranienburger Straße verwechseln wollte, die ganz woanders liegt und eine Synagoge hat, jedenfalls deren Fassade.
Wir fuhren über den Potsdamer Platz und dann nach rechts, also richtig.
„Horrible“, sagte Harry. „East Berlin is still East Berlin.“
„Wir sind in Kreuzberg“, sagte ich.
„We are in the West“, wurde Uwe deutlicher, „we just passed Checkpoint Charly.“
Es war einfach zu schön, um wahr zu sein. Kaum hatte der Fahrer die Oranienstraße erreicht, da leuchtete rechts ein großes Schild: ‚Max und Moritz‘.
Ich wollte noch sagen: ‚Wartet mal, ich will erst sehen, ob auch Platz ist!‘ –
Zu spät! Mir blieb nur noch die Quittung.
Eine echte Berliner Kneipe. Sie steht unter Denkmalschutz, erzählte uns der Wirt im Laufe des Abends. Es war voll, aber wir bekamen trotzdem einen guten Tisch. Alle waren zufrieden. Am meisten ich. Die Wände hatten die Farbe, die bei Hemden ‚Ochsblut‘ heißt. Eine Schleppe aus Stufen wand sich, von wuchtigem Geländer geleitet, in die oberen, für Hochzeiten und Beerdigungen geeigneten Räume, und das gab einem das Gefühl, in einem fidelen Treppenhaus zu sitzen.
Das Mädchen brachte die Karte und nahm unsere Bierbestellung auf.
Der Wirt empfahl seinen Wacholder-Schnaps. Na, den konnte ich brauchen!
Harry klappte die Karte auf: „Sauerbraten!“, he said, „that’s what I’ll be having.“
Wirklich, da stand er, der Sauerbraten, jedenfalls in Buchstaben.
Sebastian warnte, wir sollten uns besser erst mal erkundigen, ob er vom Rind sei, denn der echte Sauerbraten sei vom Pferd. Wieso weiß der so was?
„Okay“, sagte Harry zu mir, „tell Dorothy I didn’t come last night because her sauerbraten was not genuine.“
Ich nahm mir fest vor, Dorothee das nicht weiterzuerzählen, wusste aber gleich, dass ich solch einer Versuchung kaum würde widerstehen können. Immerhin würde ich Dorothee damit trösten, dass die Serviererin behauptete, auch bei ihnen verwende man das Fleisch der Kuh und nicht das des Rosses. Harry schien diese Auskunft nicht zu enttäuschen.
Da ich ohnehin für den nächsten Tag zum Sauerbraten-Essen verdonnert war, entschied ich mich von vornherein für etwas anderes Bodenständiges: Die informationsselige, wilhelmbuschreiche Speisekarte unterrichtete ihre Leser darüber, dass es, so um die Jahrhundertwende 1899/1900, zwei Straßen weiter einen Schlachter gegeben habe, der das Rippspeer des Schweines auf neuartige Weise selchte. Den Handwerkern und Arbeitern Kreuzbergs schmeckte der Braten, und so wurden beide populär: der Fleischer (er hieß Cassler) und sein Braten (er hieß auch Cassler, wurde aber bald orthografisch eingedeutscht: Cäsar, Zar, Kaiser – wir kennen solche Abschleifungen ja).
Wo ein Name ist, da ist auch eine Geschäftemacherei, sodass man jetzt in Hessen ‚Original Kasseler‘ bekommt, in Lourdes von der Heiligen Jungfrau geweihtes Wasser kaufen kann und am Main die von Johann Georg Lahner erstmals in Wien verkauften Schweins-Rind-Würstel als ‚echte Frankfurter‘ angepriesen werden. Profitgier, Schummelei und Marken-Diktat, so weit das Auge reicht, nur Hamburger sind wirklich von McDonald’s.
Das Kasseler bei ‚Max und Moritz‘ war leichter, saftiger und milder als gemeinhin üblich. Es bestand also kein Anlass für einen zweiten Wacholder-Schnaps. Ich bestellte ihn trotzdem. Alle waren wir froh und aßen und tranken, was uns schmeckte. Harry rauchte, ich redete, Uwe nickte und Sebastian erzählte, dass er sich von seiner Freundin getrennt habe. „Yes“, bestätigte Harry in der Taxe, „he is straight but he likes to be together with gay people.“ So war es auch nicht verwunderlich, dass er mit Uwe gemeinsam die U-Bahn am kneipennahen Moritzplatz genommen hatte, während ich Harry in der Taxe zu seinem bemäkelnswerten Hotel mit der erstklassigen Küche fuhr. Dann ließ ich mich den leuchtenden Ku’damm hinauffahren, zurück in meine gediegene Pension.
Freitag auf Samstag in Berlin: Das nach wie vor flackernde Leben, die nicht mehr ausgetobten Triebe, der ins Poesiealbum gepresste Gedanke. Gute Nacht!

1 Quelle: Wolfgang Schreiber/Deutschlandfunk: Leonard Bernsteins ‚Mass‘ – eine maßlose Messe?

Titelbild mit Material von Manfred Brückels/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
#2.32 (C) | Telefongespräche zwischen Berlin und Hamburg über Sauerbraten#2.32 (E) | Eigenartige Köpfe

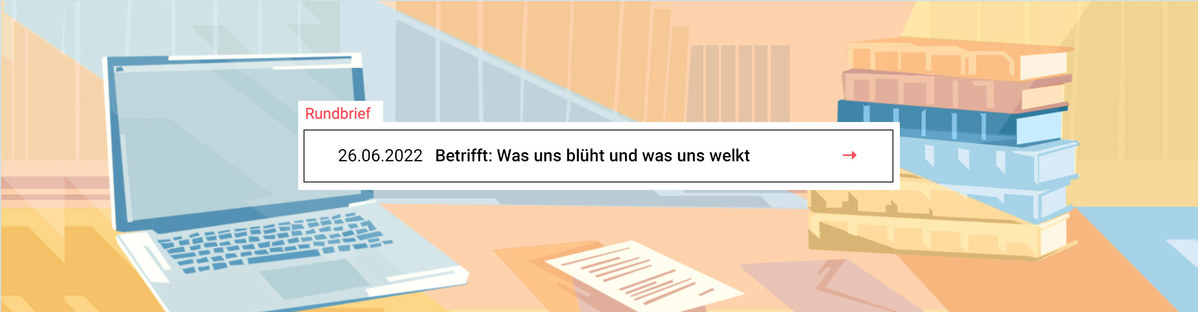







































































Ist East Berlin denn auch 2022 noch East Berlin?
Darüber streiten sich die Geister…
Mitte eher nicht, Marzahn eher ja.
Ich frag mich immer ob es da ab einem gewissen Punkt eine bewusste Entscheidung gibt, das Triebe nicht mehr ausgelebt werden. Oder ob das einfach so passiert. Also aufs Alter abgezielt meine ich.
Es kann eine bewusste Entscheidung sein, sich ab einem bestimmten Alter von Anbahnungsorten und -foren fernzuhalten.
Das klingt auch nach gar keiner so schlechten Entscheidung.
Früher war dasmit 50, heute vielleicht mit 60?
Sowas entscheidet sich ja anhand von vielerlei Faktoren. Charakter, Lebensumstände, Wohnort… Bei manchen ist das ja schon mit 40 so, andere sind mit 60 noch in Nachtclubs und Bars unterwegs.
Ah ja, Oranien- und Oranienburgerstraße – den Unterschied habe ich auch schon mal schmerzlich lernen dürfen.
In amerikanischen Großstädten ist die Verwechslung von XX-street east oder west gefährlich, wie ich einmal in Washington überleben durfte. Zwischen Mitte und Kreuzberg zu pendeln gilt als harmloser.
Es gibt ja schlimmeres als an der falschen Adresse zu landen. Bei beruflichen Terminen ists natürlich unangenehmer als wenn man touristisch unterwegs ist.
Ich stieg fein gekleidet aus und war in einem Slum-Viertel. Die Taxe war weg, lärmende schwarze Jugendliche waren da. Eine halbe Stunde später saß ich in einer anderen Taxe. „Hier halte ich nie. Viel zu gefährlich. Aber Sie brauchten Hilfe.“
Das sagte dann der nächste Taxifahrer? Lärmende Jugendliche sind ja erstmal keine große Bedrohung. Übrigens ziemlich unabhängig von der Hautfarbe.
Wenn man aber wohlhabend und wehrlos aussieht, kann das in gewissen Gegenden – unabhängig von der Hautfarbe – abends zum Problem werden.
Ist diese Kassler-Geschichte wirklich war? Das war tatsächlich ein Kreuzberger Schlachter?
„Angeblich ist Kasseler die Erfindung eines Berliner Fleischermeisters Cassel im 19. Jahrhundert.
Die Herkunft des Wortes Kasseler aus Kassel in Hessen lässt sich nicht belegen, obwohl im 19. Jahrhundert in Berlin darauf verwiesen wurde.
Eine weitere Annahme für die Wortherkunft ist die Möglichkeit, dass der Begriff Kasseler von Kasserolle (französisch: Casserolle) abgeleitet wurde, also von einem flachen Topf aus der französischen Küche, in dem Fleisch geschmort wird und der möglicherweise mit den Hugenotten nach Berlin gekommen ist. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren etwa 20 Prozent der Berliner hugenottischer Abstammung.“
(Wiki)
Eher ein Gericht für den Winter (in ungeheizten Räumen?)
Das kommt auf die Beilage an. Aber ein gutes Sauerkraut mit Kasseler ist auf jeden Fall eines meiner liebsten traditionellen Gerichte.
Meins auch. Kommt mir zwar irgenwie altmodisch vor, stört mich aber nicht.
I like men who like to be together with gay people 😉
If I like them or not depends to a certain degree on their additional qualifications. 😘
Mit einer Erkältung eine Vorstellung singen zu müssen klingt schrecklich. Wahrscheinlich für den Künstler und das Publikum gleichermaßen.
Manchmal ist die Ersatzbesetzung auch eine Qual, manchmal ist es ihr Durchbruch.
Wohl wahr. Ich bin aber in der Tat auch schon sehr positiv überrascht worden.
Mittlerweile freut man sich ja immer über ein wenig East Berlin. Also vielleicht nicht im DDR-Sinne, aber die Oststadtteile sind ja doch mit Abstand die beliebteren und „cooleren“.
Feiern in Lichenberg und wohnen in Charottenburg?