

Bei Hugendubel, dem modernen Buchmarkt auf drei Etagen, frage ich nach dem ‚Schweigen der Sirenen‘. Erst mal bekam ich nur das Schweigen der Verkäuferin. Ihrem Computer entnahm sie dann die Fehlinformation, dass es die Erzählung nicht mal mehr auf Musik-Kassette, gelesen vom unvermeidlichen Gert Westphal, gäbe, auf CD sei sie nie erschienen. Also bestellte ich mir die CD in der schummerigen Buchhandlung in der Mohrenstraße, wo ich schon das ‚Große Solo für Anton‘ und diverse Postkarten aus der Serie ‚Berliner Chic‘ gekauft hatte, die zur Illustration dieser Aufzeichnungen im analogen Tagebuch beitragen. Vorher hatte ich meine Hin- und Rückfahrkarte am Bahnhof Friedrichstraße er-standen, Schlange wie Freitag bei Aldi, nur da sind die Kassiererinnen flinker. Erschöpft kehre ich heim. Eigentlich stehe ich sowieso nur auf, um dem Zimmermädchen eine Freude zu machen, auch wenn ich es bis zwölf Uhr mittags mit ‚Bitte nicht stören‘ an der Tür demotiviert habe. Vielleicht heitert die neckische Pssst-Zeichnung auf dem Warnschild sie auf. Um so missmutiger bin ich, wenn ich mal gegen drei zurückkomme, und das Bett ist noch nicht drapiert. Aber: cool, cool, Alta! Eindeutig habe ich mir das Privileg erschlafen, ihr letzter Freier vor Feierabend zu sein. So what.
Meinen Briefkasten in Hamburg leere ich spontan, also fast nie, aber auf E-Mails bin ich megascharf. Schade, dass Anette in der Provence ist! So ein Computer-Schriftverkehr macht den Telefon-Klatsch etwas literarischer und komprimiert ihn: Wachtel-Essenz statt Hühnerbrühe. Bloß scheiße, dass man Wörter wie Handy, PC und CD nicht wegklicken kann. Solche Kürzel nehmen den Texten das Abgehobene, ein Verlust, den ich total schade finde, denn ich steh’ nun mal echt auf ‚zeitlos‘ und find’s tierisch super, wenn ich so was Bleibendes reinpowern kann in meine Sachen, spitzenmäßig. Universelle Ewigkeitswerte, Grenzüberschreitungen – fahr’ ich voll drauf ab, ganz mein Ding. Aber okay, man muss auch irdischere Brötchen backen können: Schreibsprache.
Statt längerer Reden führte ich drei kurze Telefongespräche: das erste, um wirklich fortzufahren; das zweite, um wirklich zurückzukehren; das dritte, um einigermaßen geordnet wieder wegzukommen.
Irene: Sie rief an. Es sei nicht nötig, dass ich käme, sie schaffe das schon. Wie bereits geprobt, sicherte ich ihr meine Ankunft zu. Inzwischen hatte ich ja sogar meine Platzreservierung. Und selbst wenn sie mich nicht unbedingt brauchte, so konnte sie mich doch gut gebrauchen, und, mehr, ich konnte ihr helfen.
Michael. Ich rief an. Ich wollte unbedingt eine feste Verabredung in der nächsten Woche in Berlin haben, nicht nur einen Koffer. Dienstag, halb vier, bei mir.
Volker: Ich rief an. Ich fragte ihn nach Beruf und Familie und ob er nicht Lust habe, meinen letzten Tag mit mir in Berlin zu verbringen. Dann könne er mich auch gleich mit Koffer, Tasche, Computer, Sakkos am Bügel und Tüten am Henkel mit zurücknehmen nach Hamburg. Fand er gut.
Ich wählte meine Kleidung so aus, dass sie zu einem Galerie-Besuch wie auch zu einem thailändischen Essen mit einer jüngeren wie auch mit einer älteren Dame bei wechselhaftem Wetter, nachmittags und abends passte: Hose, Jacke und Mantel. Was machen die Männer eigentlich mit dem Geld, das sie früher für Hüte und Krawatten ausgegeben haben? Stecken sie das alles in Schuhe, mit denen sie aussehen, als wollten sie auf einem Campingplatz im schottischen Hochmoor Ferien machen?
Die U-Bahn fuhr mich bis zur Station Senefelderplatz und keinen Meter weiter. Von dort an ist wegen dringender Schienen-Bauarbeiten ein Pendelbus-Verkehr eingerichtet. Die Bekanntmachung, gerahmt wie eine Sport-Urkunde im Schülerzimmer, hatte ich bei jeder U-Bahn-Fahrt gleichgültig registriert, ohne mir träumen zu lassen, dass mich das je betreffen würde. Es las sich wie die Einstellung des Fährverkehrs zwischen Murmansk und Nowaja Semlja. Aber so geht es einem ja mit den meisten Schicksalsschlägen: Der Braten verkohlt immer im Ofen der anderen, denkt man. Aber diesmal qualmte es doch unter meinem eigenen Herd.
Eine Lappalie. Der jüdische Friedhof war wieder geschlossen, aus Rücksicht auf die Toten oder aus Furcht vor Hakenkreuz-Schmierereien; der Bus stand schon da, und so konnte ich die Schönhauser Allee besichtigen, statt unter ihr entlangzufahren. Früher führte sie ja wohl – edler – zum Schloss Schönhausen, in einem Lustpark gelegen. Doch schon Ende vorvorigen Jahrhunderts hatte man die Allee mit vierstöckigen Wohnhäusern zugeknallt, denn mein ‚Meyers‘ von 1897 staunt über die Gepflogenheiten der Ortsansässigen: ‚Die Bevölkerung Berlins hat sich in den letzten Jahrzehnten in fast beispielloser Weise vermehrt. 1820:
Als ich ausstieg, liefen die Bahngleise über der Erde, auf Stützpfeilern in der Mitte der Straße. Viel Verkehr unter grauem Himmel, freudlos geschäftig. Kleine, unansehnliche Läden, hastende Menschen. Gründerzeithäuser, verschmutzt und zurechtgeflickt wie abgewetzte Hosen. Aber kaum trat ich in die Kopenhagener Straße, wurde es geruhsam. Kaum Verkehr, kaum Menschen, die Fassaden mit Sorgfalt restauriert. Hinter der dritten Querstraße begann der Gebäudekomplex des Umspannwerks, roter Klinker, monumental-futuristisch. Wie soll so ein Gebäude aussehen? Ist es dekorativ, sagen wir: protzig. Ist es schlicht, sagen wir: seelenlos. Ich fand den einzig passablen Eingang schneller, als ich es bei einem so ausladenden Bau erwartet hatte, und sah im Vorraum sofort Dorothee, eine Jüngere und das Plakat: ‚Verner Panton‘ stand drauf. Dieser Name sagte mir am 18. Juli um halb sechs nichts, aber anderen Menschen musste er schon vorher geläufig genug gewesen sein, um für ihn in eine Ausstellung zu laufen, womöglich im Pendelverkehr angekarrt!
Was ist eigentlich ein Kulturschock? In den Sechzigerjahren hatte ich einen schlechten Geschmack. Ich trug breite Krawatten über geblümten Hemden und griff abends nach farbigen Rauchgläsern, gefüllt mit Lufthansa-Cocktail, die neben VAT-69- oder Bastflaschen, tropfkerzenbestückt, standen, auf Teakholz-Tischen, in Zimmern mit unterschiedlich tapezierten Wänden. (Tagsüber griff ich bloß nach den Sternen und meinem Notenpapier.) Ich hatte weder die Tapeten ausgesucht noch das Knabbergebäck in Fischform, aber trug nun mal das geblümte Hemd am eigenen Leibe – Stilsicherere wählten Ochsblut; Trevira verabscheuten sie und ich gleichermaßen, und lustig machen konnte man sich zu allen Zeiten über alle Zeiten.
Kein Zweifel: Lufthansa-Cocktail, Kikeriki (Eierlikör mit Sinalco) und Schwarzer Kater (Johannisbeerlikör) mit Sekt, das war auch vor Kir Royal schon schlechter Geschmack, sogar am Gaumen – jedenfalls aus dem Mundwinkel der Ewigkeit bekostet, von oben herab.
Aber damals, mittendrin? Die betulichen Obstweine, die Marina, Dagi, die Berliner Studentenschaft und ich bei ‚Leydicke‘ in Schöneberg tranken, bereiteten uns keinerlei ästhetische Kopfschmerzen. Da es den Begriff ‚in‘ noch nicht gab (‚modern‘ ist nicht dasselbe), konnte auch nichts ‚out‘ sein. Das Wort ‚passé‘ war selbst passé und ‚Leydicke‘ war angesagt, nur dass man das damals nicht sagte.
In den Siebzigerjahren wurde ich geschmacklos. Zu Dagis Hochzeit erschien ich im weißen Samtanzug, mit lila Hemd und mit Blockabsätzen. Der Zug ICE ‚Provokation‘ rettet manchen blinden Passagier über geschmackliche Entgleisungen hinweg in den Bahnhof der Zustimmung. Ich bin Scheiße. Ihr seid Scheiße. Was dagegen?
Ist es ein Kulturschock, wenn ich Stühle, Lampen und Aschenbecher, die ich früher als modegegeben, also kritiklos, hinnahm, jetzt, nach ein paar Jahren, in denen mir ein paar Haare ausgefallen sind, in einem Museum als Exponate wiederfinde und sie bestaunen darf wie mittelalterliche Schnabelschuhe? Da kann ich mich ja gleich mit bestaunen. Anette hatte womöglich recht, dass ihre Vergrößerungsform Anna (ihre in Berlin studierende Tochter) in mir den älteren Herrn sehen wird. Oder sollte ich zu den jetzt zwanzigjährigen Kunststudentinnen, die sich interessiert über orangefarbenes Plastik beugen, anbiedernd sagen: ‚Cool, was? Tja Mädels – meine Zeit!‘
Im Radio muss ich es ertragen, dass meine Lieblingsstücke bezichtigt werden, Oldies zu sein. Wer keine Kinder hat, den trifft dieser Schreck schlecht vorbereitet. Genusslos lümmelte ich mich in Wohnlandschaften und versuchte mich damit zu trösten, dass Dorothee die Musik noch aus dem Volksempfänger gehört hat. Aber sie, alterslos und überall zu Hause oder nicht, war keineswegs zerknirscht, sondern stolz, damals schon schön gefunden zu haben, was jetzt die Weihen einer Ausstellung erhalten hat. Zugegeben: Mit Donaueschingen hat sie zwar danebengelegen, aber hier liegt sie richtig: auf Schaumgummi.
Als die resoluten jungen Frauen am Eingang ihre Mittel einsetzten, um zu demonstrieren, dass für heute Schluss sei (Lautsprecherdurchsage und Lichtflackern wie bei Stromsperre), gingen wir; ich kaufte vorher noch einen orangefarbenen Plastikstuhl. Zehn Zentimeter hoch. Wer durch so eine Puppenstubenversion seiner Kreationen geehrt wird, gilt als Elite-Designer.
Marion sieht edel aus wie eine florentinische Madonna, die aus dem Rahmen gefallen ist, aber sich gut gefangen hat. Sie führte uns entgegen der Richtung, aus der ich gekommen war. Am Ende des Häuserblocks war freies Gelände, das sich rechts und links weithin dehnte. Graues Gras, graue Häuser, weit weg; kleine graue Menschen, zerstreut unter großem grauen Himmel, wegdämmernde Beleuchtung, das Schwarzweißbild eines alten Fernsehapparats, drittes Programm eines absterbenden Senders. Irrlichterndes Flimmern jenseits aller Quoten.
„Der Mauerpark“, sagte Marion. „Die Straßen werden nicht wieder verbunden, nur für die Gleimstraße gibt es einen Fußgängertunnel. Sonst bleibt alles, wie es ist.“
Ich hatte keinen Grund, mich zu wundern, ich hatte ja den Stadtplan im Kopf – oder nur im Blut? Wenn man Bahn und Bus gefahren und längere Zeit gegangen ist, dann meint man, man habe sich entfernt, zum Beispiel vom Westberlin seiner Kindheit. Weit entfernt! Man ist zwar die ganze Zeit gefahren und gelaufen, aber doch immer nur entlang der Grenze. Und aus dem Stadtplan weiß ich ja, dass dort, wo die Kopenhagener Straße versickert, nur ein paar hundert Meter weiter, ach, eine neue Straße beginnt: die Ramlerstraße, in der Roland gewohnt und gearbeitet hat; der Hausflur, in dem wir noch die Jugendstil-Messingknäufe abgeschraubt und an unseren Tapetentüren in Hamburg wieder angeschraubt haben, zum dekorativen Öffnen der Abseiten. Ich kann die Hand ausstrecken, aber ich kann nichts greifen. Da fühle ich mich wieder so unverdient überlebt, wie er unverdient tot war.

Titelbild mit Material von Josef Streichholz/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (Umspannwerk, bearb.), Ken StockPhoto/Shutterstock (Bäume)

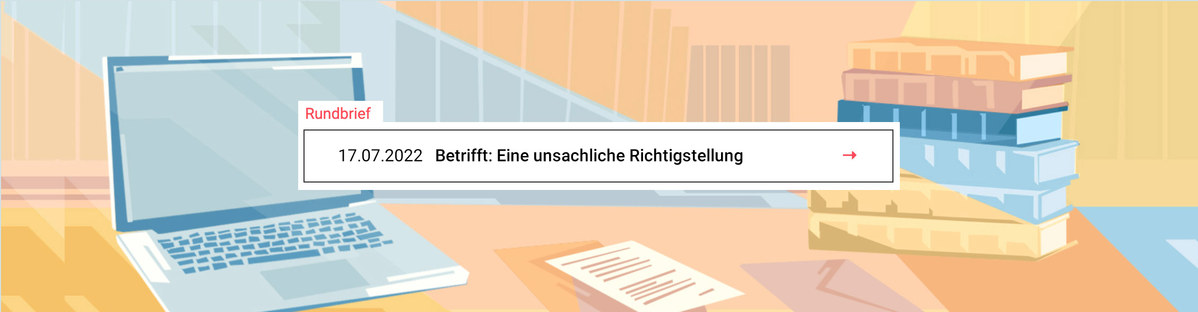







































































Ach, das mit dem Schloss Schönhausen wusste ich gar nicht
Das liegt doch im Pankower Schlosspark, nicht?
Ja.
Jetzt gehören auch die Hits der 90er schon zu den Oldies. Tja, so geht es eben.
Und bald landen unsere alten iPhones und unsere Sofagarnitur dann auch im Designmuseum.
Oder einfach auf dem Sperrmüll. So richtige Designklassiker gab es ja was die Einrichtung angeht lange nicht mehr.
Christoph Thun-Hohenstein vom Museum für angewandte Kunst hat hinsichtlich der kommenden Designklassiker eine ziemlich genaue Vorstellung: „Aus Sicht unseres Zeitalters der Klima-Moderne werden das Objekte sein, die heute als ökologisch radikal gelten, weil sie keinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen und ein neues, zirkuläres Zeitalter vorwegnehmen. […] Die Welt von morgen beruht auf technischen und biologischen Kreisläufen und kennt Abfall genauso wenig, wie die Natur Abfall produziert. Bis dahin haben wir aber noch einen steilen Weg vor uns.“
Kreisläufe sind ja schön. Abgeschlossene Perioden kann man sich besser merken. Die vollkommene Wiederverwertbarkeit von allem klingt fortschrittlich – aber auch gruselig.
Interessant wie unterschiedlich die Leute das sehen. Bei Emails bin ich immer froh, wenn sie entweder gelesen oder am besten gleich wieder abgearbeitet oder gelöscht sind. Beim Briefkasten bin ich hingegen immer enttäuscht, wenn er komplett leer ist.
Es gibt auch E-mails zum Sammeln. (Meine zum Beispiel)
Ich schicke mir sogar selbst viele wichtige Dokumente per Email. Es gibt doch kein besseres Backup.
Oh, das ist keine schlechte Idee
Das ist ja geradezu eine Bevölkerungsexplosion im 19. Jahrhundert. Wenn man sich da die Entwicklung seit den 90ern anschaut, passiert ja eigentlich gar nicht mehr viel.
Wir stehen gerade wieder vor dem nächsten Gastarbeiter-Problem.
Vielleicht wäre das sogar eine Lösung für diese unglaublichen Probleme an den deutschen Flughäfen? Da herrscht doch überall Personalmangel.
Die Türken kommen doch schon.
Genau wie Odysseus vertraue ich einer Handvoll Wachs wenn ich auf Reisen bin. Es geht zwar nicht immer ums Verderben, aber schlaflose Nächte sind ja auch schlimm genug.
Und die heutigen Sirenen klingen sowieso nicht mehr besonders verführerisch.
Laut einer der Geschichten wurden die Mädchen aufgrund ihrer Unwilligkeit zu Heiraten zu Vogelähnlichen Wesen verwandelt. Ob heute deshalb noch jemand töten würde?
Wegen der Unwilligkeit zu Heiraten? Oder wegen der Verwandlung?
Mit Vögeln ist nicht zu spaßen!