

Freitag, 21. Juli
Kopfschmerzen und Übelkeit. Ohne getrunken zu haben. Das ist wie Ausrutschen ohne Bananenschale. Man meißelt ‚WARUM?‘ in den Himmel und keinen schert’s. Wenn nichts anderes hilft, muss man eben gläubig werden oder zynisch; wandern, schreiben. Oder im Bett bleiben. Faulheit gibt es nicht. Die Frage lautet: Ist es Schwäche oder Verweigerung? Hinfälligkeit oder Protest? Ich lese so vor mich hin. Von Zeit zu Zeit öffne oder schließe ich die Gardinen, als spielten sich verschiedene Akte ab. In den Pausen wird Kamillentee gereicht. Ich erfreue mich an der Vorstellung, gepäcklos nach Hamburg zu fahren. Ohne Last …
Erst als es notwendig wird, stehe ich auf. Nicht mal eine Zahnbürste brauche ich mitzunehmen. Einen Block, zwei Stifte und die ‚Liebesfluchten‘. Ich schlendere die Friedrichstraße entlang. Es ist Zeit genug, um im ‚Kulturkaufhaus Dussmann‘ Titel zu überfliegen, in CDs und DVDs zu wühlen. Was ich möchten würde, könnte ich bezahlen, kämpfen müsste ich nicht dafür. All die Welten der Texte, Musiken, Filme – ich brauche weder zu betteln noch zu stehlen. Ich würde zahlen und ein unvergessliches Erlebnis haben oder die Tüte in der Bahn liegen lassen. Ich könnte mir das reproduzierte Kunstwerk ein zweites Mal kaufen, und wenn mir gleichgültig würde, wie es auf mich wirken mag, weil andere Dinge mir wichtiger werden, könnte ich es wegwerfen.
Das Gebiet von ‚Unter den Linden‘ bis zum Friedrichstadtpalast ist eines der besonders veränderten. Da war bis zum Mauerfall fast gar nichts, und jetzt ist da sehr viel. Nichts zum Niederknien, nichts zum Verzweifeln, einfach Spree und Stadt und nicht die Leere eines Hauptbahnhofs in der Wüste wie eine Station weiter westlich. In Berlin ist man selbst als nostalgischer Mensch gezwungen, Veränderungen zu lieben, weil der Status quo spätesten seit 1945, aber ich glaube, schon seit dem Großen Kurfürsten, unakzeptabel wäre. Wie wird es sein, wenn das laut Fontane und Alfred Kerr niemals fertige Berlin doch irgendwann mal – was die Baulücken angeht – fertig sein wird? Filmaufnahmen der Berliner Innenstadt aus den Zwanziger- und Dreißigerjahren belehren mich, dass ich zwar nicht alles mag, was jetzt neu gebaut wird, aber dass doch alles großzügiger und städteplanerisch durchdachter ist als das, was ich da so von früher über die Leinwand flimmern sehe. ‚Lebendig‘ dient dann immer als Entschuldigung für das untergegangene Berlin. Na ja, das war es wohl, gewiss ein Argument, welches Palladio-Villen nicht für sich in Anspruch nehmen können.
Ich würde gern mal dreiundfünfzig Jahre lang in Berlin gelebt haben, mit stetigen Kurzaufenthalten in Hamburg. Würde dann meine Sehnsucht dem ‚hübscheren‘, ‚eleganteren‘ Hamburg gelten? Bos Frau Ingrid sagte, noch in Berlin: „In Hamburg sehen die Menschen besser aus“ (so Bos Übersetzung aus dem Schwedischen). Was heißt das? Zufriedener? Schicker angezogen? Ingrid selbst sieht nie so aus, als müsste sie gleich raus auf den Catwalk bei ‚Lagerfeld‘. Das Straßenbild: die Fassaden – der Menschen, der Häuser, der Busse. Was liebt man an einer Stadt? Die Freunde, die Erinnerungen, die Anregungen? In allem Abfall steckt immer auch ein Einfall. Man muss sehen, man muss hören, man muss fühlen. Das gilt sicher auch für Gelsenkirchen, nur ist das ein Thema, das ich aus Mangel an Kompetenz anderen überlassen muss.
Bahnhof Friedrichstraße – Lehrter Bahnhof – Bellevue – Tiergarten – Zoo. Die vanillepuddingfarbenen hohen Kacheln. Die Treppen und Gänge. Die Staffage der Menschen. Erwartet worden sein. Abgefahren sein. Alles tut weh. Es wäre befremdlich, wenn es nicht wehtäte: Roland.
Man ist schnell draußen aus Berlin, vom Zoo bis Spandau ohne Halt in zehn Minuten. Das hat mir zu Mauerzeiten Unbehagen und vor der Mauer als Kind Furcht eingeflößt. Von Aumühle bis Hauptbahnhof dauert es in Hamburg mehr als doppelt so lange. Keine andere Großstadt der BRD lag so dicht an der DDR.
Hamburg wirkt umständlicher, Berlin zudringlicher. Aber das sind Schablonen. Ich weiß selber, dass der Bahnhof Zoo schon im Westen liegt und dass ich von dort aus, wenn ich nach Warschau wollte, länger durch Berlin fahren müsste, als es von Harburg bis Altona dauert.
Falkensee, Finkenkrug, Brieselang. Nauen. Bis auf die immer noch bedrohliche Schneise unmittelbar nach Albrechtshof gehen die Ortschaften ineinander über, verkettet durch riesige, flache Verbrauchermärkte, die den Anschluss Brandenburgs an die Konsumwirtschaft auf das Garstigste demonstrieren. Dann weht Land vorbei; so flach, als könne man dort nirgendwo Halt oder Zuflucht finden. Liebesfluchten. Republikfluchten. Auf der Schiene vergeht die Zeit beim Sinnen und Lesen wie im Fluge.
Berlin war grau, in Hamburg ist verwirrenderweise gutes Wetter. Ich steige in Altona aus und verliere mich in Ottensen. Schafskäse, Fladenbrot, Strauchtomaten. So hole ich mir ein wenig Kreuzberg ins Gemüt. Als ich aus dem Laden trete, fährt gerade ein Taxi vorbei, der Fahrer sieht meinen ausgestreckten Arm nicht mehr. ‚Hier scheinen viele Taxen entlangzufahren‘, denke ich. Die nächste kommt zwölf Minuten später. Dem ersten Eindruck vertraut man lange. Es erinnert an den Mann, dem gesagt wird: Hier auf dem Dorf wirst du nichts. Geh nach Berlin, da liegt das Geld auf der Straße! Er trifft am Anhalter Bahnhof ein und sieht ein Fünf-Mark-Stück auf dem Vorplatz liegen. Erst will er sich schon bücken, aber dann denkt er: ‚Ach nein, mit der Arbeit beginn’ ich erst morgen.‘
Ich erreiche unseren Vorplatz, auf Besuch zu Hause, und keine Chancen liegen auf dem von Candido1 gefegten Pflaster rum. Die Gepäcklosigkeit verleiht mir trotzdem etwas Unbeschwertes. Ich lege die Türken-Tüte auf den Küchentisch und mache mir mit Auspacken, Umfüllen und Abschneiden zu schaffen, um Normalität vorzugaukeln. Oliven in Othmarschen. Nichts passt richtig, aber es ist auch nichts richtig verkehrt. Wir essen und wir reden. Ich bleibe bei Wasser, Guntram bei seiner Krankheit. Später sehe ich den dritten Teil des Fernsehspiels und zeichne ihn auch auf, für Irene. ‚Väter und Söhne‘ heißt die Familiensaga. Väter und Söhne und Mütter und Töchter, so ist das eben.
Fernsehen, Fondor, Fondamente – incurabile.
Sonnabend, 22. Juli
Ich wusste: Ich musste. Also ging es auch: aufstehen, früher als sonst; zuhören, wie Guntrams Nacht war und wie sein augenblicklicher Zustand ist; gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen; mit Irene ins Elbe-Einkaufszentrum fahren, um Lebens- und andere Mittel zu besorgen (verblüffenderweise sogar – vermutlich als Ersatzbefriedigung – zwei Paar leichter, allerdings weißer Schuhe für mich, eines eher sportlich, das andere eher unsportlich. Bisher habe ich beide nicht getragen, also wird es vor 2001 nichts mehr, denn die Zeiten, in denen meine Mutter mich mit weißen Schlittschuhen zur Trainerstunde schickte, sind vorbei. Aufs Glatteis begebe ich mich nur noch, um zu streuen.); mich nach dem Parkschein befummeln, ohne mir allzu viele Fingernägel abzubrechen; auf der Rückfahrt das schöne Sommerwetter genießen und das Schicksal gemeinsam beklagen; Guntram beruhigen, weil die Besorgungen so lange gedauert haben; das Mittagessen, unterstützt von Irene, herrichten, es aufessen, die Reste verpacken, Abwasch vorbereiten; gute Ruhe wünschen; selber ausruhen: von nichts, für nichts; das Tatar anmachen; Kapern suchen und wissen, es geht auch ohne; Brot knusprig wärmen; Käse aufs Brett legen; die Wahl Holz oder Porzellan der augenblicklichen Eingebung überlassen; Guntrams Rollstuhl in die Küche schieben und in aller Hast essen, weil das Fernsehprogramm nicht wartet; dabei dennoch ein paar launige Bemerkungen beisteuern, aber vorher Irenes Tatar nachpfeffern, weil sie sich vor rohem Fleisch zu ekeln begonnen hat, was sie für ein Anzeichen von Krebs hält, er jedoch Hustenanfälle bekommt, wenn er Pfefferkörner in seinen Speisen erspäht; Guntram vor dem Fernsehbildschirm platzieren und beide betrachten; Ton für Guntram leiser stellen (Nerven); Ton für Irene lauter stellen (Gehör); das Gesehene kommentieren, dabei die Argumentation bisweilen Weggeschlafener nicht so ernst nehmen, dass es zu einem Streit kommen könnte; Meinungsverschiedenheiten durch Gute-Nacht-Kuss ausbügeln; das Sonntag-Mittagessen besprechen; bei letzten Verrichtungen helfen; in den ersten Stock, also ins eigene Reich, zurückkehren und bis zum Einschlafen nicht vergessen, keinen Alkohol zu trinken.
Who is who (Akkordeon)
1 – Candido
[kandiˈdo]
Candido Fernandez war der portugiesische Hausmeister des pompösen Herrenhauses, zu dem früher unser possierliches Kutscherhäuschen gehörte.

Titelbild mit Material von Jan Derk Remmers/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

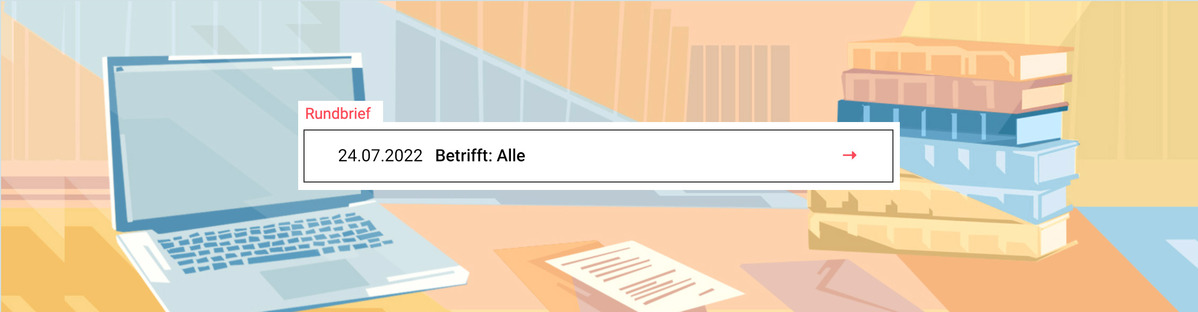







































































Aufstehen, bevor es notwenig ist, sollte auch nur in Ausnahmefällen in Betracht gezogen werden…
Außer einem prophylaktischen Gang ins Bad fällt mir da auch nichts ein.
Das große WARUM? nützt halt so wenig, weil man keine Antwort zurückgeschrien bekommt. Es kümmert einfach keinen (genügend).
Trotzdem kann man es sich manchmal nicht verkneifen.
Weil man sich selbst mehr kümmert als es die anderen tun?
Weil suchen manchmal wichtiger ist als finden.
Wahrscheinlich ist das doch sogar so, dass man in Berlin Veränderungen lieben MUSS. Für Nostalgiker ist die Stadt einfach zu aktiv.
Auch, seit es das Schloss als Fassade wieder gibt?
Na spätestens wenn man um die Ecke geht, wird man ja gleich wieder desillusioniert.
Ich finde es trotzdem ganz hübsch!
Dreiviertel pseudo-antik, ein viertel ziemlich modern – so kann man sicher sein, dass keiner zufrieden ist. – Also, ich finde das Schloss-Forum als Abschluss der Linden völlig in Ordnung und wesentlich besser als diesen grauenhaften Palast der Republik vorher.
Es soll da auch ganz frisch ein paar neue Gastronomie-Anlaufstellen geben. Ich werde es beim nächsten Besuch mal auskundschaften.
Das Cafe verspricht ‚kleine pikante und süße Leckereien‘,
das Restaurant ‚ehrliche, ideenreiche und undogmatische Küche‘. Na, dann mal viel Glück!
Meinungsverschiedenheiten durch Gute-Nacht-Küsse ausbügeln … so ist das eben 😉
Solange man das tut, geht’s ja. Im Streit Schlafen gehen macht nämlich schnell alt.
Ich träumte dann immer von Versöhnung. So blieb ich jung.
Wer das kann, hat es deutlich besser. Ich mache mir meistens zu viele Gedanken um ruhig einschlafen zu können.
berlin und fertig? das werden wir alle nicht erleben
Aber bei NewYork und Wuppertal auch nicht.
Was sollte das denn auch überhaupt heißen? Wann wäre eine Stadt denn ‚fertig‘?
Wenn all ihre Bürger ausgestorben sind.
Dass in Berlin das Geld auf der Straße liegt, haben tatsächlich schon einige gedacht. Die meisten sind wohl enttäuscht worden.
Weiss man nicht spätestens seit „arm aber sexy“, dass in der Stadt finanziell wenig zu holen ist?
Der Ausspruch galt wohl besonders für den Senat. Die Start-up-Szene hofft nach wie vor auf Wunder.
Hoffen darf sie ja