

Dienstag, 25. Juli
Ungefrühstückt wie immer verließ ich das Haus: um frühstücken zu gehen, bei ‚Möhring‘. Einst hatte das Möhringer Frühstück Tradition – da saß ich dann mit Roland am Ku’damm. Jetzt sitz’ ich mit Papier am Gendarmenmarkt. Solange ich bloß meinen Schreibblock vor mir hatte, ging’s, aber seit das Tablett mit der Serviererin auf mich zukam, habe ich meinen Essblock, und alle hungernden Kinder Indiens können ihn nicht wegwälzen. Dabei hatte es so verheißungsvoll begonnen: Die Serviererin nahm das bescheidene Zögern in meiner Stimme wahr, als ich das ‚kleine Frühstück‘ bestellte.
„Also mir würde es reichen“, pflichtete sie mir bei.
Wahrlich, mir reicht es.
Ich sehe von der Hölle auf mich herab: ein Literat im Café, gleich hinterm Dom, in der Hand keine Schreibverhärtung, sondern ein weiches Ei, das er soeben köpfen will. Die anschwellende Vormittagssonne beginnt heiß zu werden, das Ei ist bereits kühl. Wer keinen Appetit hat, lässt sich weder davon noch von dem austretenden Glibber die Stimmung verderben. Jetzt versucht er, Jesus zu spielen: Er will den Stein erweichen. Es misslingt. Nachdem die Butter, statt sich zu verteilen, das Brötchen zerfetzt hat, bedeckt er den klaffenden Riss, mehr geniert als beholfen, mit dem Schleier der Salami. Auch die Weise, auf die er den Teebeutel aus der Kanne fischt und neben den Aschenbecher gleiten lässt, zeugt davon, dass er mit seinen Gedanken weg ist, weit weg: ein glücklicher Mensch. Wie Sisyphos.
Schluss mit den Faxen! Das Manuskript, das ich gebeten worden war zu überfliegen, ließ sich nicht überfliegen: ein Absturz nach dem anderen. Entweder ich konnte Uwe und Thommy sagen: „Euer Bernstein-Konzept ist ganz nett, macht weiter so“, oder ich müsste ihnen zeigen: „Ihr habt gar kein Konzept, und euer Vorschlag, wie ihr die verkehrten Voraussetzungen filmisch umsetzen wollt, ist Quatsch.“ Ich entschied mich für den zweiten Weg, und das bedeutete, dass meine Anmerkungen länger wurden als das Skript. Um drei brach ich ab und ging.
Um halb vier kam Michael. Michael ist immer pünktlich und Michael macht immer alles zu Fuß. Beides gefällt mir.
Architekten sind in Berlin Stars wie anderswo Fußballer und Pop-Sänger. Architektur ist in Berlin Tagesgespräch, weil Bauen in Berlin Alltag ist. Eine Ausstellung, die besonders große Aufmerksamkeit findet, ist deshalb die Darstellung baulicher Pläne für Berlin, Zeichnungen und Modelle, zwischen 1900 und 2000, mit dem verspielt verschachtelten Titel
‚Stadt der
ARCHITEKTUR
der Stadt‘.
Wegen des großen Andrangs während der ersten Wochen hatte Michael angesichts der Warteschlangen aufgegeben, und so konnten wir jetzt gemeinsam betrachten, was an Bemerkenswertem und Merkwürdigem für Berlin ersonnen, gestaltet und verworfen worden ist.
Ein zusätzlicher Reiz war, dass die Ausstellung im Neuen Museum stattfindet. Wie ja jeder weiß, wurde es 1841 von Stüler entworfen, weil doch die königlich preußische Sammlung am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts so rasch angewachsen war. Da hat man dann noch die Hauptfassade mit turmartigen Risaliten eingefasst, die im Obergeschoss mit Karyatiden geschmückt waren, und das im Mitteltrakt befindliche Treppenhaus mit einem offenen Dachstuhl versehen, damit König Friedrich Wilhelm der Vierte ein bisschen aufgemuntert wurde. Er war doch so durchdrungen von seinem Gottesgnadentum und trotzdem ‚immer‘ bereit, seine Feinde durch Menschlichkeit und Entgegenkommen zu entwaffnen! Klar, dass er, ‚der Romantiker auf dem Thron‘, dann tief enttäuscht war, wenn er nicht Dank erntete. 1848 bekam er Saures, 1850 das Neue Museum. Erst ab 1986 wurde der Bau schrittweise gesichert, erst 2005 soll er fertig sein. Für diese Ausstellung wurde er vorübergehend geöffnet. Die Ruine stiehlt den Exponaten die Schau. Immer wieder sieht man empor zu den Wandmalereien, Stuckaturen, Ornamenten und fragt sich: In welchem Umfang kann und soll man das restaurieren, und ähnlich wie beim Jüdischen Museum wird man sich später daran erinnern, was man vorher gesehen hat – man wird nicht nur hinnehmen, sondern vergleichen.
Das taten wir natürlich auch bei der Betrachtung dessen, was Berlin war, werden sollte und noch ist. Man empfindet die ganze Zeit im Konditional: Wenn das Schloss nicht zerstört worden wäre, wenn Hitler sein Germania und Honecker seine Hauptstadt der DDR hätte bauen können … Man sieht auf all diese Berlins, die nicht Berlin sind, und begreift, dass Architektur, wenn sie über die Planungsphase hinwegkommt, steingewordener Traum ist: Manifeste der Leichtfertigkeit und des Größenwahns, Hort der Einkehr und der Besinnung. Die nie verwirklichte Idee, die verlorene Vergangenheit und die fantastische Utopie – sie sind die Musen des Träumers, und manchmal sind sie ihrer regierenden Schwester, der Gegenwart, überlegen. Manchmal auch nicht. Was nutzt der Artemis-Tempel, wenn Herostrat ihn zerstört hat? Was bringt es, Neuschwanstein zu benasrümpfen? Die Touristen finden es toll und zahlen gerne Eintritt. Das Echte ist nur ein ideeller Wert, und ich trage lieber teure Jeans von Armani, wenn ich besser in ihnen aussehe, als ursprüngliche von Levi’s. So schnell habe ich mir das Schummeln abgeguckt! Dabei war ich in meiner Abiturklasse der letzte Verfechter des Absoluten und bin es – ganz subjektiv – immer noch: Der Nabel ist da, wo ich den Bauch habe. Wir sind zurück im Jahr 2000.
Michael war besonders beeindruckt davon, dass alle Modelle Originale waren. Mir wäre das gar nicht als etwas Besonderes aufgefallen: bei Modellen? Wenn da irgendetwas Blondes über den Laufsteg ankommt, ist das doch sowieso immer Claudia Schiffer.
Wir vertieften uns so planlos in die Exponate und die Räumlichkeiten, dass wir darauf aufmerksam gemacht wurden, dass die Wärter gleich Feierabend machen würden. Die Berliner, nein, wahrscheinlich alle Lautsprecherstimmen sind gleich. Ob sie sagen, ‚Sie werden gebeten, das Gebäude zu verlassen‘ oder ‚Nächster Halt: Hölle, Ausstieg links‘ – man kann sich gar nicht vorstellen, dass diese Stimme einen Kehlkopf hat. Die Automatenstimme des Elbe-Parkhauses – ‚Bitte entnehmen Sie die Karte!‘ – hat dagegen die Menschlichkeit des Glasauges.
Es ist wunderbar, mit Michael durch die Straßen zu gehen, weil man ganz unangestrengt das erfährt, was man wissen möchte: kompetent und unbeflissen. Was wird abgerissen, was bleibt, was kommt. Eine Fortsetzung des Ausstellungsbesuchs. Schön, dort, wo Anfang der Neunzigerjahre einzelne Häuser und Ansätze zu sehen waren, jetzt Strukturen zu erkennen: Straßengabelungen, Plätze. Wir durchquerten die Hackeschen Höfe und gingen durch die inzwischen vertrauten Kleinstadtgassen: Vom St. Hedwig-Krankenhaus (1855) über den 1943 von der Gestapo plattgemachten Jüdischen Friedhof (1671) bis zu Clärchens Ballhaus (alterslos) – alles, was das Herz nicht begehrt. Im ehemaligen Volkskaffeehaus für arme Bürger ‚residiert heute ein Nobelrestaurant‘, wie der ‚Wegweiser‘ pikiert anmerkt, ‚und dokumentiert den Prozess veredelnder Umnutzung (Gentrification)‘.
Michael führte mich durch einen wenig auffälligen Eingang in die Heckmann-Höfe, eine frühere Maschinenbau-Fabrik, die ganz eindeutig auch der ‚Gentrification‘ zum Opfer gefallen ist, vorher allerdings schon dem Krieg und dem Sozialismus. Boutiquen und Galerien – vom ‚Wegweiser‘ als ‚Einzelhandel‘ bezeichnet – und ein Lokal, das überraschenderweise ‚McBride’s‘ heißt und vom ‚Wegweiser‘ etwas pauschal ‚Gastronomie‘ genannt wird.
Es war noch nicht ganz sieben, und so bekamen wir Fensterplätze auf der Veranda. Draußen war durch den Regen hindurch ein Ausschnitt aus dem Berlin E. T. A. Hoffmanns zu sehen: ein Stück Haus, eine Mauer, ein Bau – wie von Eduard Gaertner im Biedermeier gemalt, wenn auch schlichter als dessen Motive. Unsere Motive waren auch schlicht. Michael wollte essen, und ich wollte sitzen. Ich ließ Michael zu Wort kommen, weil er immer so interessante Dinge aus seinem Privatleben zu berichten weiß, und er redet so unbefangen über sie wie Chirurgen über Blinddärme. Tierfleisch nimmt er nicht in den Mund, deshalb konnte ich ihm nichts von meinem Steak abgeben, und auch sonst ist er von Giuseppe doch recht verschieden.
Als wir lange genug gesessen und gegessen hatten, setzten wir kulturmäßig noch eins drauf und gingen zum Postfuhramt. Dort hatte die Fotoausstellung: ‚Magnum-Fotografen‘ bis 23 Uhr geöffnet, und nach zwei Stunden Elend, Krieg und Kummer reichte es mir auch. Vier Etagen lang ungeschminkte Wirklichkeit ist einfach zu viel. Die Kamera hat ohnehin leicht etwas Reißerisches; Bild an Bild Verwundete, Entstellte und Entwurzelte – man wird dem dargebotenen Leid nicht gerecht, zum Schluss bewegt einen nur noch die Frage, wo der Ausgang ist.
Auf der Oranienburger Straße saßen Menschen, die sich nicht kannten, an langen Tischen zusammen und tranken Bier: Es regnete nicht mehr, es schneite noch nicht. Also feierten sie ‚Sommer‘.

Titelbild mit Material von Janericloebe/Wikimedia Commons, gemeinfrei
#2.45 | Den richtigen Zug nehmen#2.47 | Morgendlicher Spätnachmittag

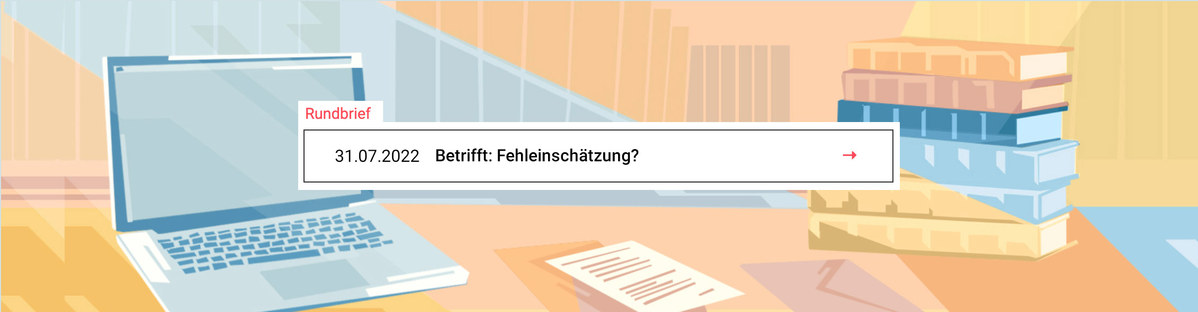







































































Bei den Franzosen wäre unser kleines Frühstück wohl schon ein ausgedehnter Brunch.
Frühstück, eine Mahlzeit, die man sich nicht verdient hat, weil man bloß schlief, sollte jeder verantwortungsbewusste Bürger meiden. Hirschhausen mit seiner 16-Stunden-Pausen-Theorie findet das sicher auch.
Als ob man sich alles erst verdienen müsste!
Ein Croissant reicht doch auch. Am Wochenende vielleicht noch ein gekochtes Ei dazu.
Und ’ne Schinkenstulle.
Ach was für Zeiten als die c/o Berlin noch im alten Postamt zuhause war. Die neuen Räume sind natürlich schick, aber gefiel die alte Location immer etwas besser.
Berlin ist eben eine Stadt, die sich schnell verändert. Da hilft es nicht viel zu sagen, was man früher alles besser und spannender fand.
Manchmal hilft es doch: schwärmerische Nostalgie.
Als ich mal beruflich in China war, war ich erstaunt und fasziniert was Architektur alles kann. In Berlin bin ich dann aber trotzdem froh, dass nicht alle Entwürfe einfach durchgewunken werden.
Es werden schon ziemlich viele durchgewunken …
Aber die meisten sind doch eher belanglos und langweilig. Zumindest wenn man den Vergleich nach Asien zieht.
In Berlin prägt ja kaum jemand das Stadtbild so wie Chipperfield und sein Architekturbüro. Alle Bauten gefallen mit ehrlich gesagt aber auch nicht.
Es kommt ja immer auf das Gesamtbild an.
Oh, ein „Prozess veredelnder Umnutzung“ macht sowas wie die Gentrification gleich viel aushaltbarer.
Auf dem Papier mag das so sein. Draußen sind die Folgen die gleichen.
Ironie muss auch sein dürfen.
Ob diese Umnutzung letztendlich immer veredelnd ist, darüber streitet die Nachbarschaft wohl noch. Aber der Begriff ist trotzdem ein schöner.
Dass der Kietz schöner wird, wollen alle. Dass er teurer wird, will keiner.
Seit Corona bin ich auch ein passionierter Fußgänger geworden. Man spart sich die stickige U-Bahn und sieht deutlich mehr von der Stadt. Da ändert auch dieses 9€-Ticket nichts.
Es gibt Strecken, die sind vergnüglich zu durchlaufen. Es gibt andere, da fährt man beim nächsten Mal lieber drunter durch.
Da hilft nur die Erfahrung. Oft gibt es ja dann einen schöneren Umweg.